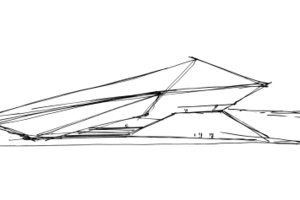Wahnsinn, nur ein Dezibel Verlust! Nur eines! Von vorne aus dem größten Orchestergraben (der Welt?) kommend bis hinauf in die letzte Reihe des vielleicht schönsten zeitgenössischen Konzertsaals (der Welt?). Nur ein Dezibel Verlust ... Dieser Messwert kurz vor der Eröffnung des Festspielhauses war Roman Delugan Grund zur Freude, zum ausgelassenen Stolzsein beinahe. Was noch übertrumpft wurde vom musikalischen Leiter des Hauses, Gustav Kuhn, der nach ein paar Proben mit seinem Orchester nicht umhin konnte, seiner Begeisterung jugendsprachlichen Ausdruck zu verleihen: „Geile Akustik! Das können Sie ruhig schreiben: richtig geil!“
Mit „richtig geil“, ich darf es ja so schreiben, könnte man das Projekt im Tiroler Erl insgesamt auf einen Nenner bringen, aber dann wäre die Geschichte darüber auch schon zu-ende. Also anders. Von draußen, von ferne, aus der Vergangenheit, in einer chronologisch geordneten Verlaufsgeschichte.
Privatinitiative lädt Architektenprominenz
Erl ist eine Gemeinde mit knapp 1 500 Einwohnern. Ihre grenznahe Lage zu Deutschland (Bayern) hat sie im Verlauf der Geschichte immer wieder in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt. Der Ort wurde zweimal komplett zerstört. Wovon die Bewohner die Nase voll hatten, und irgendwann im 17. Jahrhundert gelobten, alle sechs Jahre die Passion Christi aufzuführen, wenn der Ort von weiterer Kriegsgreuel verschont bliebe
(urkundlich gesichert ist die erste Aufführung 1613). Der Ort blieb verschont, die Passionsfestspiele, die mit denen in Oberammergau die ältesten Europas sind, gehören seitdem zu Erl wie der Dom zu Köln. Nach einem Brand des alten Passionsfestpielhauses entschied sich die Gemeinde für den Entwurf des damals jungen Architekten Robert Schuller (1929-1990), der von 1957-1959 realisiert und eröffnet wurde. Unter großem Protest in der Region; die heute unbestritten großartig in die Landschaft eingefügte Architektur war den Landsmännern und -frauen zu gewagt, zu wenig bescheiden, also „zu modern“.
Der spartanische Bau Schullers mit elegantem Schwung und schönen Details, dessen riesiges Volumen (1 500 Sitzplätze) von außen nicht ablesbar ist, hat, trotz oder wegen der offen gebliebenen Dachkonstruktion, eine bis heute äußerst befriedigende, auch international gesehen überdurchschnittliche Akustik. Gerade letzteres, wie auch die Dimension des Saals, das Rohe der Sichtbetonwände, die spartanischen Klappsitzreihen, die ganze Direktheit des Ortes veranlassten 1997 den Dirigenten und Regisseur und späteren künstlerischen Leiter, Gustav Kuhn (mit Andreas Schett), dazu, hier die im folgenden Jahr 1998 eröffneten Tiroler Festspiele zu gründen. Wagner stand und steht auf dem Programm, natürlich Bruckner und weitere Große der großen, sinfonischen Besetzungen. Und weil Wagner immer gut ankommt beim zahlungs- und reisewilligen internationalen Opern-Publikum, musste irgendwann ein weiterer Konzertsaal auf den Hügel (nicht nur Bayreuth hat also einen solchen); im Winter steht der Betrieb im Schuller-Bau still, er war von Anfang an als Sommerhaus konzipiert, im Winter also nicht zu heizen.
Da der Bau des neuen Festspielhauses
im Wesentlichen eine private Initiative ist – Hauptfinanzier ist die Privatstiftung des Strabag-Eigners Hans Peter Haselsteiner, der seit 2005 auch Präsident der Festspiele Erl ist – konnten die Tiroler Festspiele 2006 einen
geladenen Wettbewerb ausloben; den konnte 2010 schließlich das Wiener Büro Delugan Meissl Ass. Architects für sich entscheiden. Gegen Büros wie beispielsweise Fasch und Fuchs, Dietmar Feichtinger Architects, das Atelier Kempe Thill oder Zaha Hadid. Den rund 40 Mio. € teuren Neubau realisierten die Wiener in nur 21 Monaten Bauzeit, am 26. Dezember 2012 wurde das Spektakel „Festspielhaus“ mit einem ausverkauften Konzertabend und anschließendem Feuerwerk einer Art Feuertaufe unterzogen und ohne größere Zwischenfälle eröffnet.
Nicht wie ein Pförtnerhaus
Sie hätten, so die Architekten, den Wettbewerb wohl aus zweierlei Gründen gewonnen. Zum einen durch die Prägnanz und die Ikonografie ihres Entwurfes, zum anderen auch, weil sie den Bestand nicht wie ein Pförtnerhaus für ihren Neubau hätten aussehen lassen. Respekt gegenüber der Landschaft ließen sie auch walten, sie schoben
ihren Bau so weit wie möglich in den anliegenden Felshang hinein; aber auch nicht weiter. Den Schwung des Schuller-Baues, der sich, wie Roman Delugan erläuterte, in den Berg hineinschraube, nahmen sie auf und leiteten ihn aus dem Berg wieder hinaus. Der mehrfach gefaltete, im Umschreiten sich kontinuierlich verändernde Baukörper scheint das von dort aus gesehen zu bestätigen, von woanders aus wieder nicht. Überhaupt ist es nicht einfach, die Gestalt des Neubaus, seine Dimensionen, seine vielfältigen Dynamiken zu erfassen, sie auf das Raumprogramm innen zu übertragen. Wo und wie liegt der Musiksaal? Was befindet sich in den Spitzen, den Knickfalten, wie gelangt man hinein und zur Promenade zum Schuller wieder hinaus? Wie kommt Licht ins Innere, wenn doch kaum Fensteröffnungen zu sehen sind? Und stimmt es tatsächlich, dass die anthrazit-
farbenen Faserzementplatten lediglich mit zwei Grundformen die Fassadenabschnitte des Hauses abwechslungsreich bespielen? Es stimmt.
Interessanterweise handeln sowohl der Alt- wie der Neubau der Festspiel- beziehungsweise Passionshäuser mit vergleichbaren Entwurfselementen: Geschlossenheit, Implementierung (Landschaft) und zugleich solitäre Setzung sowie beredte Inszenierung einer Morphologie. Und Zeitgenossenschaft, die nicht den Hauch von Anbiederung erkennen lässt. Im Falle des Neubaus von Delugan Meissl muss man hier jedoch fragen, ob das Handschriftliche, das Elke Delugan Meissl für das Büro konstatierte, als sie nach Ähnlichkeiten des Entwurfes mit Arbeiten für Porsche, das EYE Film Institute oder das noch Projekt seiende V&A Museum gefragt wurde, ob dieses Handschrift Seiende nicht bloß eine handwerklich erarbeitete Form ist, in welche in einem spekulativem Akt die jeweilige Aufgabe gegossen wird. Ein Methode, die von international nachgefragten Büros praktiziert, weil auch erwartet wird.
Man könnte, vorbei an einer Bar, hinaus zum Passionsspielhaus von Schuller gehen
Wer den Neubau besuchen will, muss – kommt er mit dem Auto – zuerst am grünen Hügel längs fahren, um sein Fahrzeug in einer Garage unterzustellen, die der Präsident und
Finanzier Haselsteiner sich hat bauen lassen; damit endlich niemand mehr auf den Wiesen des Hügels parkt, damit der Gang zur Musik bereits inszenierter Akt wird, damit dem Schuller-Bau die Referenz erwiesen werden kann und vielleicht auch, dass er ein Fundament für seine persönlichen Räume vis-a-vis den beiden Musikhäusern erhält. Dass hier die Wiener nicht auch zum Zuge kamen, ist äußerst bedauerlich, aber glücklicherweise stehen Parkhaus mit privaten Empfangsräumen und Saunalandschaft oben drauf weit genug entfernt.
Der Zugang zum Festspielhaus ist ein schöner wie schlichter Aufstieg durch die bis zum Boden reichende Fassadenlandschaft hindurch. Oben gibt es einen kleinen, durch das mächtige Dachvolumen geschützten Vorplatz vor dem Foyer, das man durch die verglaste Gebäudefuge betritt. Der Boden des Foyers ist leicht aufwärts geneigt, man verlangsamt, so gebremst, den Schritt. Geradeaus die Garderobe, rechts die Schalter.
Schräg rechts geht es in den Konzertsaal, Parkett rechts, links geht es weiter leise bergauf und wieder ein paar Stufen hinab zum Konzertsaal Parkett links. Oder über eine gegenläufige Treppe nach oben ins kleine Foyer, von welchem aus die Galerie links und rechts zu erreichen ist. Von hier aus gelangt man auch auf einen Balkon, der vom gleichen Dach wie der Haupteingang geschützt ist und von welchem aus der Blick über den Inn hinweg bis auf die Bayrischen Alpen reicht.
Man könnte, wenn man wollte, das Foyer unten auch wieder verlassen, vorbei an einer Bar hinaus zum Schuller über die von einem hangseitig spitz zulaufenden Fassadensegment begleitete Promenade. Hierüber soll der physische Austausch zwischen den beiden Häusern laufen, hierüber können Musiker, Staffage und Ausrüstung pendeln. Vom oberen, kleinen Foyer aus gelangt man auch in die Raumlandschaft Büro, Werkstätten, Übungsräume etc., deren Haupterschließung jedoch über die Anlieferung in der wenig spektakulären Südfassade erfolgt.
Die auf dieser Seite beruhigt scheinende Geometrie des Volumens wird auf der Ostseite fast schon banal einfach, aber sie muss hier auch nicht mehr sein: Eine gebäudehohe, im Farbton der Faserzementplatten gehaltene Putzfassade steht einer mittels Spritzbeton und Anker gebändigten Felswand gegenüber. Eine schlichte, gewendelte Fluchttreppe, zwei Fenster, eine Tür auf Erdgeschossniveau und ein paar merkwürdig montierte Technikkästen ganz oben sind hier die Störungen einer ansonsten perfekten Zweidimensionalität. In dieser am Grund rund 3 m breiten Schlucht, die sich nach oben hin leicht weitet, offenbart sich die Brachialität der Setzung: 110 000 t Fels wurden gesprengt und beiseite geschafft, um dem Neubau die beste Position am Hang zu geben. Wäre der große Musiksaal hinter der Bühne offen, ginge der Blick gegen den gesicherten Fels.
Im Zentrum der wie wild gestikulierenden Skulptur: der Saal
Also der Saal. Er steht im Zentrum der wie wild gestikulierenden Skulptur, der gegenüber seine Geometrie geradezu simpel
erscheint. Eine langgestreckte, rechteckige Box bildet das Gefäß, in das hinein Bühne und Nebenbühne, der Zuhörerraum mit seiner plastischen, akustisch wirksamen
Holzverkleidung und die komplette Bühnentechnik oben gepackt wurden. Die steil ansteigenden Ränge ermöglichen eine gute Sicht von allen Plätzen und wirklich, in der letzten Reihe ist ein Dynamikverlust mit dem Ohr nicht wahrzunehmen. Fast hat man eher noch den Eindruck, dass der Klang unterhalb der nach vorne geneigten Abschlusswand des Saals, hinter der der Raum für die Ton- und Lichtregie liegt, konzentrierter ist als auf den mittleren Rängen.
Nur 862 ZuhörerInnen (732 auf der Tribüne und 130 mobile Sitzplätze) gibt der Saal einen Sitzplatz, im Vergleich zum alten Festspielhaus ist das gut die Hälfte. Doch mehr war nicht herauszuholen in dem vom Budget, aber auch dem einzuhaltenden Volumen vorgegebenen Rahmen. Nicht zuletzt ist diese Reduktion auch dem tiefen Orchestergraben zu verdanken, der mit 160 m² Flächen zum Größten gehört, was große Musikhäuser in der Welt für ihre Orchester an Raum bieten. Der Hubboden des Orchestergrabens erlaubt es auch, dass hier ein kleines kammermusikalisches Ensemble im Zentrum einer dann speziell hierfür aufgebauten Bestuhlung aufspielt. Oder man schließt die tiefe Bühne hinter dem Orchestergraben mit schwenkbaren Holzelementen und konzentriert damit die Größe des maximal Möglichen auf das Intime eines minimal Notwendigen.
Um den großen Saal herum wurden die Büros und Übungsräume, die Werkstätten und Lagerräume platziert. Viele sind hier fens-terlos oder so hinter die Fassadenverkleidung gesetzt, dass der Ausblick auf das Inn-Tal von Faserzementplatten und/oder Stahlträgern verhangen ist. Die Einsingräume der Stars, die Garderoben und Schminkräume liegen an langen Fluren, die sich schon mal leicht biegen, die sich heben oder senken und in deren oberen Zwickel auch schon mal Stahlträger (unter Putz) einschneiden. Das Meiste dieser ziemlich verwickelten Raumlandschaft macht einen äußerst pragmatischen Eindruck; die fließenden Räume, das Elegante der Raumfügungen, Licht und Weite sind ganz deutlich dem Publikum vorbehalten; das kann man, wenigstens der männliche Part, in den Toilettenräumen sehen, die über große Fenster auf die Landschaft draußen ausgerichtet sind.
Die Herleitung aus dem Bestand muss nicht überzeugen
Aber zurück zum Anfang. Und gleich nach draußen, vor den Hügel mit seinen beiden Musikhäusern, die ihre eigentliche Größe so gut zu verbergen verstehen. So gut, dass man gerne auf ein gegenteiliges Größenverhältnis kommen möchte. Welche Musik hier auch immer gespielt wird, ist eigentlich nicht wichtig. Selbstverständlich sind störende Nebengeräusche aus der Klimaanlage oder scheppernder Ton oder gar kein Nachhall ausgeschlossen. Der Neubau von DMAA verkörpert sicherlich eher das Martialische der Musiken von Wagner oder Bruckner, mehr jedenfalls, als der eher Kirchbau seiende Bau von Schuller. Das Wort vom „Tarnkappenbomber“ liest man immer wieder, es wird der Skulptur allerdings nicht gerecht. Ganz im Gegenteil ist der Neubau eher ein Ausrufungszeichen, ein – trotz aller Versuche, ihn mittels „Tektonik“ oder anderen Bezügen auf den Landschaftsort topologisch zu tarnen – Fremdkörper in der Landschaft. Einer, der nicht mit dem Bestand konkurriert, sondern ihn, formal gesehen, sehr überzeugend ignoriert. Die Herleitungen der neuen Linie aus dem Schuller-Entwurf überzeugen aber den nicht, der den DMAA-Entwurf als etwas ganz Eigenes ansieht.
Und das lässt sich beschreiben in der Gegensätzlichkeit zum 1950er-Jahre Entwurf Schullers, dessen Archaik bestensfalls in der roh belassenen Konstruktion, den unverblendeten Wänden, die Festungsqualitäten besitzen, der offenen Dachkonstruktion und ganz sicher auch der ausschließlich natürlichen Klimatisierung zum Ausdruck kommt. Die Grundform, das gebauschte Segel, die sich entrollende Fahne, das Weiß der Fassade mit den dekorativ gesetzten Öffnungen spricht von Aufbruch, von Zukunftsgläubigkeit, vielleicht auch von spiritueller Gläubigkeit. Dem haben die Wiener nun ein säkulares, scharfkantig abweisendes wie Neugier weckendes Objekt gegenüber gestellt. Zukunftsgläubigkeit ist hier lediglich noch ein Bezug auf
Scienes-Fiction-Idiome, Zukunftsskepsis findet sich im Verweis auf die Härten der Natur, den Fels mit Schründen und Abbrüchen, dunklen Schluchten und bedrohlich ragenden Spitzen (Wagner!). Dass im Inneren, am Ende des Raumflusses über leicht geneigte Böden und steile Treppen, Flure und Plätze ein Raum mit klarer Orientierung und Holzkokon wartet, ahnt man nicht. Hier inszenieren die Architekten sehr lässig Überraschung und sind – auch wenn der Raum ohne Musik ist – selbst überrascht vom Gefühl des Ergriffenseins (Elke Delugan Meissl); das sich aber auch nur als solches einstellen kann, weil die äußere Hülle alles andere als das bewirkt.
Also doch: Alberichs Tarnmantel
Wenn man den Ort Erl wieder verlässt, über die A93 nördlich in Richtung Rosenheim, und über geringste Dezibel-Verluste sinniert oder darüber, ob ein Raum geil klingen kann, winkt rechterhand das Passionsspielhaus von Schuller über den Inn herüber. Der Neubau dagegen verschwindet, trotz seiner Größe, überraschend in der Dächerlandschaft der großen Holzbetriebe im Ortsteil Weidau. Oder in der Landschaft. Und dann kommt doch der Gedanke an den Tarnmantel, an Siegfried und Alberich, und dass Gustav Kuhn mit seinen Ring-Inszenierungen in dem neuen, von ihm mitkonzipierten Festspielhaus einen adäquaten Ort gefunden hat. Gei… also: wunderbar! Be. K.