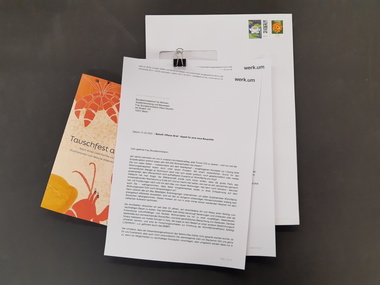„It’s the Wohnfläche, stupid!“
Was die Bundesbauministerin anlässlich einer Pressekonferenz auf der IBA 2027 in Stuttgart in Anlehnung an Bill Clintons Wirtschaftswahlkampf formulierte, trifft den Kern: Nur wenn wir künftig komfortablen Wohnraum auf weniger Quadratmetern als heute realisieren, können wir den Co2-Ausstoß im Gebäudesektor tatsächlich reduzieren. Doch es gehört noch mehr dazu.
Text: Anne Kettenburg, Arne Steffen
 Neue Grundrisse für neue Lebenssituationen: Clusterwohnungen im Rüsselsheimer Projekt von werk.um
Neue Grundrisse für neue Lebenssituationen: Clusterwohnungen im Rüsselsheimer Projekt von werk.um
Grafik: werk.um
 Bestandsertüchtigung in Rüsselsheim: Mit neuen Flächenangeboten den
Bestandsertüchtigung in Rüsselsheim: Mit neuen Flächenangeboten den
Platzbedarf im Laufe des Lebens besser abbilden
Foto: Thomas Ott
Wer die Bedeutung von Klima- und Ressourcenschutz und des Erhalts unserer Lebensgrundlagen immer noch nicht begriffen hat, den kann man guten Gewissens heute schon (mindestens) „stupid“ nennen. Die meisten – auch die am Bau Beteiligten – haben begriffen, dass sich unser Geschäft verändern muss. Und viele bemühen sich, meist im Rahmen der öffentlich diskutierten Lösungsansätze. Dämmen, nachwachsende Rohstoffe, regenerative Energien. Aber bisher wurden im Sektor Bau die Klimaschutzziele so deutlich verfehlt, dass das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) im Juli 2022 „nachsitzen“ musste.
Das hat sicherlich viele Gründe, die alle noch weiter bearbeitet werden müssen. Da jedoch – so die Überzeugung von werk.um – die Strategien sich bisher zu sehr auf die oben genannten „öffentlich diskutierten Lösungsansätze“ beschränken, werden die notwendigen Klimaschutzerfolge ausbleiben müssen.
Daher soll im Nachfolgenden der Fokus auf einen bisher vernachlässigten Einspar-Ansatz der Nachhaltigkeit gelenkt werden. Theoretisch könnte der Schutz unserer Umwelt durch bereits entwickelte Möglichkeiten funktionieren. Es gibt bereits Plus-Energie-Häuser, die allerdings in der Herstellung schon viel von der sogenannten grauen Energie in Anspruch genommen haben. Es gibt Häuser, die entweder weitgehend aus nachwachsenden Rohstoffen oder auch aus Baustoffen und -elementen errichtet werden, die schon ein früheres Leben in anderen Gebäuden hatten.
Doch diese bisher im Fokus stehenden Strategien haben einen wesentlichen Faktor bisher außer Acht gelassen: uns, die Menschen, die Bewohnerinnen und Bewohner. Ebenso bedeutend wie der Ressourcenverbrauch der Objekte ist nämlich das Konsumniveau der Bewohnerschaft. Ein enormer (Ressourcenverbrauchs-) Unterschied liegt nämlich in der Art der Nutzung von Gebäuden, ob in einer 120 m² großen Wohnung entweder vier Studierende gemeinsam leben oder auf der gleichen Fläche eine junge Oberärztin, die sich die Fläche schlicht leisten kann.
 Bei der Konstruktion des Projekts K76 achteten die Planer:innen von Beginn an darauf, beste Voraussetzungen für eine leichte Umbaubarkeit zu schaffen
Bei der Konstruktion des Projekts K76 achteten die Planer:innen von Beginn an darauf, beste Voraussetzungen für eine leichte Umbaubarkeit zu schaffen
Foto: werk.um/Thomas Ott
So lange schon vermeintlicher Klimaschutz von Gebäuden nur an den Gebäuden, zum Beispiel in Form von kWh/m2a bemessen wird, ist in nahezu gleichem Maße der Wohnflächenverbrauch pro Kopf gestiegen. Und so haben wir einen Großteil der Ressourceneinsparbemühungen seit Bekanntwerden der „Grenzen des Wachstums“ im Jahre 1972 in eine fortwährend gestiegene Wohnfläche-pro-Kopf umgewandelt. Hat sich denn niemand gewundert, dass wir trotz all der Dämmmaßnahmen und immer aufwendigerer Heiz- und Lüftungstechnik keine Einsparungen in diesem Sektor erreicht haben? Waren wir so stupid, dass wir das so Offensichtliche nicht sehen konnten? Oder sehen wollten?
Die Grenzen eines ökologisch intakten Systems sind bereits deutlich überschritten. Deswegen müssen nicht nur der Bau und Betrieb von Gebäuden weiter effizienter gestaltet werden, sondern eine Verringerung des Konsumniveaus ist ebenso vonnöten. Diese Erkenntnis dringt auch immer weiter in die Politik vor. So hat Bundesbauministerin Klara Geywitz in der Bundespressekonferenz „Sofortprogramm für den Gebäudesektor“ am 13.07.2022 gesagt: „Und ein Punkt, das ist auch etwas, was ganz ganz wichtig ist für mich, ist die Frage, dass wir über Wohnflächenkonsum eine Diskussion führen in dieser Gesellschaft, […] dass individuelles Wohnen etwas mit dem Klima zu tun hat, weil wir natürlich sämtliche Effizienzgewinne der letzten Jahre auffressen, dadurch, dass die Wohnfläche pro Person immer mehr steigt.“
Dabei scheint man sich einig, dass nicht wir, die Bewohnerinnen und Bewohner zum freiwilligen Leben auf weniger Wohnfläche überredet werden sollen, sondern, dass man uns durch den Umbau der (Infra-)Strukturen ermöglichen möchte, mit einem Weniger auszukommen. Im besten Fall, ohne dabei ein gefühltes Komfortniveau einzuschränken.
Wie viel? Die Dimensionen
Seit 1995 ist die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf in Deutschland von 38,1 m² auf 47,7 m² in 2022 gestiegen. Für 2030 wird eine durchschnittliche Wohnfläche von 52 m² prognostiziert. Das klingt auf die einzelne Person ja nicht so dramatisch. Ein Mehr an Wohnfläche scheint im Laufe des Erwachsenwerdens ganz normal. Es wollen ja auch nicht alle Menschen in einer WG wohnen. Wenn dann noch eine Familie gegründet wird, ist nachvollziehbar, dass man für die Lebensphase eine angemessene Behausung sucht. Doch – und das ist einer der Gründe für die ständig steigende Wohnfläche-pro-Person – wenn diese Lebensphase abgeschlossen ist, dann verkleinert sich der auf zwei Personen geschrumpfte Haushalt selten. So ist dann die Wohnfläche von 1995 bis 2022 gestiegen. Und wird vermutlich ebenso ungebremst weiter wachsen.
Doch lohnt die Aufregung überhaupt? Sind denn die in 27 Jahren nicht mal zehn zusätzlichen Quadratmeter Wohnfläche kritisch? Auf das Individuum betrachtet: nein. Auf 84 Mio. Deutsche: ja. Sehr. 84 000 000 x 10 (zusätzliche)m² = 840 000 000 (neuzubauende)m² Wohnfläche. Das entspricht 10 Mio. Wohnungen mit 84 m².
Und weiter gedacht müssen für die prognostizierte weitere Erhöhung auf 52 m2 Wohnfläche pro Person bis 2030, also über 4 m2 pro Person, über 400 000 neue Wohneinheiten p. a. gebaut werden. Das entspricht der aktuellen Zielmarke für Neubau der Bundesregierung. Wobei es bei der hochgerechneten Menge an Wohnraum nicht um die Linderung der Wohnungsnot geht, sondern nur darum, dass wir alle weiter die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf erhöhen können.
Spätestens mit dieser Erkenntnis wird der (erhoffte) Hinweis einer Bundesbauministerin auf der IBA in Stuttgart nachvollziehbar. Alle, die 2027 immer noch nicht begriffen haben, dass wir die Wohnfläche pro Kopf mindestens nicht mehr steigen lassen dürfen, sind stupid.
Das Umweltbundesamt bezieht in der Frage, wie viel Wohnfläche denn vertretbar wäre, zumindest aus Sicht der Nachhaltigkeit eine klare Position. In der 2019 veröffentlichten Rescue-Studie wurde dargelegt, dass das 1,5°C-Klimaschutzziel nur zu erreichen ist, wenn die durchschnittliche Wohnfläche bis 2050 auf 41 m2/ Kopf sinken wird (www.umweltbundesamt.de/rescue). Eine Wohnfläche, die im Übrigen dem Standard von 2004 entspricht.
Zum Umziehen je nach Lebenssituation kann man niemanden zwingen – man kann aber Anreize schaffen
Grafik:werk.um
Neu denken statt neu bauen
Wie kann es weniger werden? Es klingt schwierig, ist doch bereits ein Stopp des Flächenwachstums eine offenbar große Herausforderung. Und es ist ja unbestritten, dass viele Menschen zu eng wohnen, dass Mieten in Ballungsräumen nicht für alle Bevölkerungsschichten zu bezahlen sind. Wenn all diese Menschen ein Mehr an Wohnfläche bekommen sollen, müssen die, die sehr großzügig wohnen, etwas abgeben. Schon das sind wir nicht gewohnt. Aber es kommt ja noch besser: Die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf soll ja sogar sinken.
Ein Teil der Bevölkerung scheint es sich leisten zu können, auf viel Fläche zu leben. Oder andersherum: Es lohnt für viele nicht, auf weniger Fläche zu wohnen. Wenn man also nicht die Freiheit beschneiden will, so wohnen zu können, wie man glaubt es zu müssen, dann müssen Anreize geschaffen werden, dass es attraktiv und im besten Fall attraktiver wird, auf weniger Fläche zu wohnen. Attraktiv meint nun nicht nur attraktiv in wirtschaftlicher Sicht. Es könnte auch aus sozialer Sicht besser sein, anders zu wohnen als alleine in der 4-Zimmer-Wohnung. Es könnte auch komfortabler sein, zum Beispiel, ohne Treppen zu wohnen. Oder ohne großen Garten, den man nicht mehr allein bewirtschaften kann und will.
Ein anderer Teil der Bevölkerung wohnt größer als notwendig, weil keine passenden Wohnangebote am Markt angeboten werden. So ist die überwiegende Zahl von Wohneinheiten in Deutschland für Familien geplant worden. Doch zugleich leben in den Ballungsräumen mittlerweile mehr als 50 % 1-Personenhaushalte. Trotzdem gibt es für diese sehr große Zielgruppe kaum ein für sie entwickeltes Wohnraumangebot. So leben die Alleinlebenden in Deutschland im Durchschnitt auf fast 67 m2. Und Senior:innen in 1-Personenhaushalten leben auf fast 80 m2.
Ein weiterer Teil lebt auf – im Sinne des Artikels – zu viel Wohnfläche, weil die Lebenssituationen von Menschen sich meist schneller ändern, als die Wohnfläche gewechselt oder angepasst werden könnte. Kinder ziehen irgendwann aus, Paare trennen sich und oft bleibt eine Person auf der Fläche, auf der vorher mehrere gewohnt haben.
Vor dem skizzierten Hintergrund muss festgestellt werden, dass es für alle, die es sich leisten können, keine Gründe gibt, auf weniger Flächen zu leben. Dass der Bestand nicht zum Bedarf passt, dass entweder die Wohnungen entsprechend den Lebensphasen wachsen und schrumpfen sollten oder Menschen häufiger umziehen sollten.
Daraus lässt sich ableiten, welche zwei Rahmenbedingungen geändert werden müssen, um dem Ziel von 41 m2/Person näher zu kommen: Anreize schaffen und den Bestand umbauen, dass es den Menschen leichter wird, flächeneffizienter zu leben.
 Neue Grundrisse für neue Lebenssituationen: Clusterwohnungen im Rüsselsheimer Projekt von werk.um
Neue Grundrisse für neue Lebenssituationen: Clusterwohnungen im Rüsselsheimer Projekt von werk.um
Grafik: werk.um
Fördern, lenken, gegensteuern
Notwendig ist ein entschiedenes Miteinander von Politik, Förderinstrumenten, Wirtschaft und Interessensverbänden. Zehn Voraussetzungen, damit veränderte Marktvoraussetzungen die Menschen motivieren, flächeneffizienter zu wohnen
- Wohnflächeneffizienz muss viel höher als bisher auf der Agenda von Gesellschaft und Baupolitik platziert werden und ist entsprechend zu kommunizieren
- Regularien gestalten, die den Bestandsumbau gegenüber dem Neubau wirtschaftlicher werden lassen
- Anreize schaffen, um das Wohnen auf kleiner Fläche attraktiver werden zu lassen (förderliche Rahmenbedingungen wie die Möglichkeit einer gleichbleibenden Quadratmetermiete bei Verkleinerung + Wohnflächenberatung – Förderprogramme für schrumpfende Regionen)
- Beteiligte und Betroffene über Möglichkeiten und Angebote zum Tausch von Wohnungen informieren
- Nutzbarmachung von bisher unsichtbarem Wohnraum nach Daniel Fuhrhop fördern (Untermiete wie Wohnen für Hilfe + verkleinernder Umzug + altersgerechter Umbau mit Wohnungsteilung + Formen des flächensparenden und flexiblen Wohnens)
- Der Suffizienz dienliche Geschäftsmodelle entwickeln und begünstigen (Beispiel: „Wohnraummanagement statt Vermietung“)
- Nutzungsgebot von ungenutzten Wohnflächen erlassen
- Ausweisung von neuen Wohngebieten unterbinden
- Abbau von rechtlichen Barrieren wie Bauordnungsrecht bei Verkleinerung/Teilung von Wohnungen beschleunigen
- Formen des experimentellem, bezahlbaren Wohnungsbau zur Weiterentwicklung in Richtung der oben genannten Kriterien subventionieren.
Unter den oben skizzierten Marktbedingungen würden sich das Angebot auf dem Wohnungsmarkt verändern. Es würden Strukturen, neue Wohnangebote, zeitgemäße Grundrisse angeboten werden, die es den Menschen einfacher machen, flächeneffizienter zu wohnen.
 Beim Projekt K76 wird durch die Koppelbarkeit und Trennbarkeit der 60 m²-Einheiten eine bunte Mischung im Haus ermöglicht
Beim Projekt K76 wird durch die Koppelbarkeit und Trennbarkeit der 60 m²-Einheiten eine bunte Mischung im Haus ermöglicht
Foto: werk.um / Thomas Ott
Und nun?
Um bei der Eröffnung der nächsten IBA 2027 in Stuttgart beim Thema Wohnfläche nicht stupid da zu stehen, braucht es jetzt Action. Das Thema muss ins öffentliche Bewusstsein gebracht werden. Die Politik kann – und soll bitte – viele mögliche Fördermittel- und Baurechts-Weichen so stellen, dass es Anreize gibt, Wohnflächeneffizienz als wichtigen und relevanten Entscheidungsparameter aufzunehmen. Sowohl aus der Sicht der individuell Wohnenden wie auch aus der Perspektive der Wohnungswirtschaft.
Und schon jetzt können alle, die sowieso Gebäudebestand in den kommenden Jahren nicht nur energetisch sanieren, sondern auch modernisieren (weil beispielsweise die kleinen Bäder aus den 1950er Jahren nicht mehr marktgerecht sind), prüfen, ob im Zuge der damit verbundenen Baumaßnahmen mit einem kleinen Mehr – wie die Rüsselsheimer GEWOBAU es plant, siehe Praxisbeispiel – der Wohnraum wirklich zukunftsorientiert umbaut. Dass dort Raum entsteht für eine veränderte Gesellschaft, für neue Wohnnutzungsverhalten, für eine höhere Wohnflächeneffizienz.
 Autor:innen: Anne Kettenburg, Arne Steffen,
Autor:innen: Anne Kettenburg, Arne Steffen,
Partner:in und Geschäftsführer:in
von werk.um architekten, Darmstadt
www.werk.um.de
Foto: werk.um
Beispiele
Neue Wohnformen im Bestand: Eine Umfrage unter der Bewohnerschaft im Berliner Viertel, einer Siedlung mit 1 091 WE aus den 1950er- und 1960er-Jahren in Rüsselsheim hatte ergeben, dass 40 % der Befragten an Formen des gemeinschaftlichen Wohnens und 50 % an temporär zubuchbaren Räumen interessiert sind. Darauf wurde im Rahmen einer Zukunftswerkstatt der kommunalen Eigentümerin GEWOBAU entschieden, ein Pilotprojekt zu starten: Umbau von 1-2 Geschossen eines Gebäudes in Clusterwohnungen und zusätzliche, nach Bedarf mietbare Gäste- und Arbeitszimmer.
Es ist beabsichtigt und erwünscht, dass die neuen Angebote neue Dynamiken im Quartier auslösen und neue Zielgruppen ansprechen.
Dabei ist der Geschäftsleitung wie auch der Verwaltung durchaus bewusst, dass Clusterwohnungen und zubuchbare Räume eine Änderung des bisherigen Geschäftsmodells mit sich bringt. In Zukunft wäre man nicht mehr in erster Linie daran interessiert, ohne viel Aufwand Mieter:innen lange in einer Wohnung zu halten. Vermieter:innen würden zu Wohnraummanager:innen mutieren, die im engen Kontakt und Austausch mit der Mieterschaft immer wieder neu nach sinnvollen und flächeneffizienten Wohnlösungen für wechselnde Bedarfe gemeinsam suchen. Die zusätzlichen Baukosten für den Umbau zu Clusterwohnungen und zubuchbaren Räumen (bei Baukosten der Sowieso-Sanierung von ca. 1,1 Mio. €) wurden mit 150 000 € kalkuliert.
K76- Neubau in leicht anpassbarer Struktur und Konstruktion. Wenn neu gebaut wird, dann sollte ein Gebäude so konzipiert werden, das es den Menschen möglich macht, darin flächeneffizient zu wohnen. K76 in Darmstadt erfüllt viele der Voraussetzungen dafür:
– Genossenschaft als Gesellschaftsform macht Wohnen sicher und leicht, Wohnflächen zu verändern,
– Skelettbau, in welchem selbst die Wohnungstrennwände in Trockenbau ausgeführt wurden,
– frei einteilbarer und individuell geplanter Ausbau, der zu einem bunten Mix im Haus führt: Singles verschiedener Altersgruppen, eine WG, Paare, Familien mit bis zu vier Kindern,
– sehr einfache Haustechnik (in jede WE führt nur eine Strom- und eine Kaltwasserleitung), die mit wenig Aufwand umgebaut werden kann,
– autonome Grundwohneinheiten mit 60 m² Wohnfläche, die über einen Laubengang erschlossen werden, vertikal und horizontal gekoppelt und wieder getrennt werden können,
– Gemeinschaftswohnung mit Gästezimmer, zentraler Waschküche im Keller, Fitnessraum, Brotbackofen vergrößert die zur Verfügung stehende Nutzfläche.
Es wurden in den 5 Jahren seit Bezug schon Wohnungen getrennt/gekoppelt. Die Gemeinschaftswohnung wurde während der Pandemie sowohl als Hort wie als Co-Working-Space genutzt.