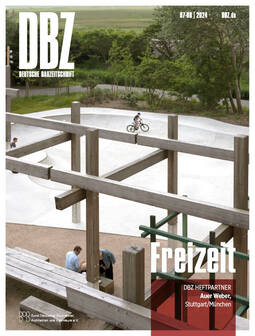Das Normative immer wieder in Frage stellen
Zwei junge Architekten gewinnen einen hochschulintern ausgelobten Realisierungswettbewerb und ihr Studierendenhaus der TU Braunschweig räumt die Architekturpreise nur so ab. Gibt es dafür Gründe, vielleicht gar eine ganz neue Art des (Zusammen-)Arbeitens? Wir sprachen mit den beiden in Berlin.
 Gustav Düsing, Max Hacke
Gustav Düsing, Max Hacke
Foto: Benedikt Kraft
Sieht nach Arbeit aus, bei Euch! Arbeit, die sich hoffentlich so auszahlt wie bei eurem Studierendenhaus in Braunschweig, das mit wirklich renommierten Preisen überhäuft fast schon nicht mehr zu sehen ist! Hattet ihr mit diesem Preisregen für euer erstes Haus gerechnet?
Gustav Düsing (GD): Nein. Aber können wir mal über etwas anderes sprechen?
Zudem wart ihr im „Heute Journal“ … das schaffen nur die Stars der Architektur.
GD: Das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber das Projekt ist schon länger her. Natürlich sind wir sehr, sehr stolz auf den Deutschen Architekturpreis, den Mies van der Rohe Award, den DAM Preis … Vielleicht bekommen wir es noch einmal klar, wieso unser Haus – das wir sicherlich für jeden dieser Preise für würdig ansehen – derart erfolgreich ist. Tatsächlich sind wir da sehr naiv reingegangen, haben entworfen, wie wir es für richtig hielten. Und da schon gemerkt, dass der Diskurs in eine andere Richtung geht, dass alle fast ausschließlich über Holzbau als die Zukunft in der Architektur gesprochen haben. Das hat uns leicht verunsichert. In dem Studierendenhaus ist ordentlich Holz drin, aber eher versteckt.
Ich schließe mal an das Stichwort „Diskurs“ an: Trotz Stahl und Glas habt ihr offenbar exakt die aktuell diskutierten Themen gebaut und, das scheint mir zentral, eine soziale Architektur realisiert, was immer und überall zu kurz kommt.
Max Hacke (MH): Ja, auf jeden Fall. Uns war mit Tag 1 in der Entwurfsphase klar, dass es in dem Wettbewerb nicht nur um einen besonderen Entwurf ging, sondern auch darum, eine ganz besondere Bauaufgabe umzusetzen. Wir wollten das supersoziale Programm, irgendwie einen neuen Gebäudetypus, der die sozialen Dinge am Campus in den Vordergrund stellt. Dass das Haus mehr oder weniger direkt nach der Corona-Pandemie aufgemacht hat, hat unseren Ansatz bestärkt, weil wir alle gespürt hatten, dass der Campus genau diese Programmierung gebraucht hat.
An wen konkret hatte sich der hochschulinterne Wettbewerb gerichtet, wer durfte mitmachen?
GD: Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fakultät 3 konnten mitmachen. Das sind Architektur und Bauingenieurwesen.
Professoren nicht?
GD: Professoren nicht, explizit nicht, denn die hatten den Wettbewerb ja organisiert und wollten mit ihm dem Nachwuchs die Chance geben, dass deren Entwurf auch gebaut wird. Ich war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter, hatte die Einladung zum Wettbewerb – die per E-Mail verschickt wurde – gelesen und mir war schnell klar, dass das alleine nicht geht. Da habe ich meinen alten Studienkollegen Max gefragt, ob er nicht Lust hätte, das mit mir zusammen zu machen.
Weil alleine …
GD: … macht es keinen Spaß. Und ich war mir sicher, dass ich mit Max einen produktiven Diskurs haben könnte, vielleicht das Resultat unseres gemeinsamen Studiums. Theoretisch hätten so um die 60 Teams Arbeiten einreichen können, es kamen aber nur zwölf, glaube ich.
„Weit aus dem Fenster gelehnt“: Wie hat es sich angefühlt, so ein wichtiges Gebäude planen und realisieren zu müssen für jemanden, der noch nicht auf der Baustelle gestanden hat?
MH: Ich bin immer noch überrascht und froh, dass sich unser Entwurf von der Einreichung bis heute so gut wie gar nicht verändert hat. Klar, wir sind tiefer ins Detail eingestiegen, haben hier und da konzeptionell weiterentwickelt. Wahrscheinlich haben wir das dem besonderen Ort der Architekturfakultät und der reinen Architektenjury zu verdanken.
Also erstes Projekt und gleich höchstdekoriert: Wie fühlt sich das gerade an?
MH: Wir waren ja tatsächlich eher die Unbekannten, ein bisschen die Underdogs denen gegenüber, die schon seit Jahren da waren. Für den einen oder anderen war es frustrierend, dass ausgerechnet die Neuen das Projekt zugeschlagen bekommen, das zudem noch so erfolgreich ist.
GD: Für mich fühlt es sich gut an. Es gibt natürlich Kollegen, die schon Ewigkeiten an einer Sache arbeiten und diese Anerkennung, die Aufmerksamkeit noch nicht bekommen haben, die ihnen aber fraglos zusteht. Wir haben mit unserem ersten Projekt gleich alles abgeräumt. Wenn ich dann höre, dass wir einfach nur Glück gehabt hätten, empfinde ich das schon auch als unfair. Wir haben einfach einen guten Entwurf abgegeben, der hat den Wettbewerb gewonnen und fertig.
Fertig. Du hast es gerade schon angedeutet: Wie kommt ihr nun aus dem „Fokus Studierendenhaus“ heraus? Indem ihr nachlegt, klar!
GD: Ich habe gerade gemeinsam mit FAKT einen Wettbewerb für die Neue Architekturschule Siegen gewonnen, das wird sicher auch ein tolles Projekt mit viel experimentellen Ansätzen.
MH: Ja, weitermachen! Ich habe gerade mit Leonhard Clemens einen Wohnungsbau in Berlin fertiggestellt und baue mit zwei Londoner Kollegen, Yannick Guillen und Francisco Esteras, eine KiTa in Berlin.
Nochmal zum Thema Anfänger: Wurdet ihr unterstützt bei der Arbeit?
GD: Ja, ohne wäre es nicht gegangen! Wir hatten das Bauingenieur-/Bauleitungsbüro IWB an der Seite, das war unsere Wahl. Wir wollten kein anderes Architekturbüro, sondern ein Ingenieurbüro. Da sind die Rollen klar verteilt. Wenn ich es nicht verdrängt habe: Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Panik, dass wir es nicht schaffen.
Aber doch, eine Sache fällt mir noch ein: Sehr unvermittelt kam irgendwann aus der Denkmalpflege: „Nur über meine Leiche!“ Den Konflikt konnten wir dann aber am Ende beilegen [s. auch hier auf S. 6 od. 7].
MH: Überhaupt hatten wir gute Kollegen an der Seite. Was auch daran lag, dass wir unser Team in Teilen selber zusammenstellen durften. Sehr zu empfehlen. Ich habe da schon andere Erfahrungen gemacht, da wurden uns Fachplaner von Bauherrnseite vor die Nase gesetzt … Da entsteht eine ganz andere Dynamik mit allen Konsequenzen auf allen Ebenen.
Schaue ich auf die Bauzeit, gab es doch sicher auch das Thema der rasant steigenden Kosten?
GD: Auf jeden Fall. Schon während der Planungszeit. Was auch daran lag, dass eine Universität ein komplexer Organismus ist, und da sind sehr viele Personen, die entscheiden wollen. Vor Corona hieß das, dass wichtige Entscheidungen nur in einem persönlichen Gespräch getroffen wurden. Sagte einer der Teilnehmer ab, verschob sich die Entscheidung, gerne mal monatelang. Dann hatte der Preisindex sein Übriges getan, sodass es auf jeden Fall teurer geworden ist. Wenn man sich jetzt die Kosten anschaut, die wir zu verantworten haben, Kostenguppen 300 oder 400, dann geht das eigentlich. Es gab unvorhersehbare Sachen. Da war der Baugrund doch nicht so gut, wie es im Baugrundgutachten stand, es gab erhöhte Brandschutzanforderungen, als noch im Wettbewerb formuliert. Aber am Ende haben wir ein relativ günstiges Hochschulgebäude gebaut.
Was zudem eine ganze Menge kann. Preis-Leis-tung scheint zu stimmen.
GD: Unbedingt. Zudem haben die ja nicht nur ein Gebäude gekriegt, sondern auch eine riesige PR-Kampagne. Die war inklusive und läuft immer noch, wir wir jetzt gerade sehen!
Hängt an mir, wie ich den Text redigiere. Gibt es deutlich mehr Einschreibungen an der Uni?
GD: Das weiss ich nicht, aber bei Architekturstudierenden ist die TU bundesweit wieder im Gespräch. Ich schätze, dass die meisten, die etwas mit Architektur zu tun haben, das Studierendenhaus auf dem Tisch liegen hatten. Natürlich war es auch ein sehr mutiger Schritt seitens der Uni, dieses Verfahren zu machen, unseren Entwurf auszuwählen und umzusetzen. Aber jetzt kann sich die Universität als Vorreiter betrachten mit dieser neuen Art von Campus-Gebäude, das sozial ist, wie Max schon sagte. Kein ruhiger Lernplatz, sondern ein sehr lebendiger, durchaus auch mal geschäftiger, lauter Ort. Das ist neuartig.
Es gibt dieses schöne Wort „Anfängerfehler“. Fehler dieser Art dienen nicht selten dazu, etwas grundsätzlich voranzubringen. Habt ihr sowas auch erlebt?
MH: Dazu gibt es einige Geschichten zu erzählen. Ich glaube auch, dass Anfängerfehler – oder Naivität – auf jeden Fall ein kreativer Faktor sein kann. Wir sind auch naiv in unsere erste große Entwurfsaufgabe gegangen und wie schnell haben wir uns im deutschen Normenwald wiedergefunden! Aus dem mussten wir uns Norm für Norm wieder herauskämpfen; beziehungsweise haben wir immer wieder versucht, das Normative kontinuierlich in Frage zu stellen.
Könntest du ein Beispiel nennen?
MH: Ein Beispiel wäre die bodentiefe Verglasung. Die hatten wir von Anfang geplant, aber nach DIN-Norm darf man eben nicht per se bodentief verglasen. Wir haben uns da sehr schnell der Entwurfsparameter bedient, die wir schon seit Tag 1 hatten. Ein 3 m überstehendes Vordach, dazu eine kleine Fassadenrinne, leichtes Gefälle weg vom Gebäude, anderes. Das und weitere Details hatten wir angeführt, um unseren Bauherrn dazu zu bewegen, von der Norm abzuweichen.
Und das zu quittieren, hoffe ich!
GD: In dem Fall haben sie unterschrieben. (lacht)
Habt ihr euch gefunden, weil ihr ähnlich seid?
GD: Ehrlich gesagt sind wir uns gar nicht ähnlich. Ich dachte, das mit Max ist eine gute Ergänzung. An der AA in London waren Max und ich eigentlich in zwei komplett verschiedenen Lagern.
MH: Es gibt schon Schnittstellen. Unsere gemeinsame Experimentierfreude, der Drang, neue Ansätze suchen, der ist auf jeden Fall bei uns beiden vorhanden.
Was bleibt denn jetzt? Eine Freundschaft, eine Arbeitsgemeinschaft? Ihr geht auch viele getrennte Wege?
GD: Ja, aber wir sind ja auch wiederum nur ein Teil eines größeren Arbeitsnetzwerks. Max hat seine Wettbewerbscrew und ich habe meine. Wir sind vielleicht das, was man als offene Beziehung bezeichnen könnte. Es hat auch Vorteile, wenn man alleine einfach kompromisslos sein kann. Dann brauche ich aber manchmal auch einen Sparringspartner, um Sachen auszutüfteln. Beides möchte ich mir nicht nehmen lassen.
MH: Offene Beziehung … (lacht) Es gibt immer wieder Dinge, die zwischen uns wirken und manchmal eben nicht. Dann suche ich mir, sucht sich Gustav sich jemand anderen. Daraus ist mittlerweise ein kollaboratives Arbeitsnetzwerk von Architektenkollegen gewachsen.
Klingt nach neuronalen Strukturen, in denen sich immer wieder neue, relevante Verknüpfungen bilden. So arbeitet euer Studierendenhaus auch, mit kleinen Einheiten, die sich immer wieder neu konstellieren!?
MH: Ja, es geht um den Diskurs, der sich schärft. Man arbeitet mit Freunden, Kollegen zusammen, hat ein relativ vertrautes Verhältnis. Im diskursiven Zusammenarbeiten geht es um das Lernen, darum, dass man etwas voranbringt. Die besten Arbeitsgemeinschaften sind die, die aus dem Studium erwachsen sind und immer noch ein Gespräch pflegen.
GD: Arbeitsgemeinschaften dieser Art zu folgen ist wie eine Überlebensstrategie aus einem Geben und Nehmen. Klar, hier müssen viele auch einmal ohne Lohn arbeiten, just for Credit. Das kann nur für eine gewisse Zeit funktionieren, vielleicht wird es auch nicht ewig in Kollaborationen weitergehen können.
Jetzt spreche ich mit den Youngstern und habe noch kein einziges Mal „Künstliche Intelligenz“ gehört, AI, KI … what ever!
GD: Wundert mich nicht. Das Entwerfen ist der Spaß an der Architektur. Warum soll ich mir das von einer AI wegnehmen lassen?
MH: AI-Design nimmt dem Ganzen auch die Naivität, von der wir gesprochen haben. Und wenn sich auf dem Naiven das Beste gründet, warum dann AI?!
Letzte Frage. Was ist das nächste Ziel?
MH: Karriereziel?
Keine Ahnung.
GD: Halbmarathon. (lacht) Ich möchte weiterhin auf keinen Fall irgendwelche Aufträge annehmen müssen, weil ich Geld verdienen muß. Das war bisher immer die Idee von meiner Praxis, dass ich Architektur nur mache, weil es mir Spaß macht.
MH: Experimentierfreude leben und einfach besser zu verstehen, was Architektur kann, welche sozialen und kollektiven Dinge Architektur bewirken kann. Das würde ich gerne besser verstehen.
Mit Max Hacke und Gustav Düsing unterhielt sich DBZ-Redakteur Benedikt Kraft am 29. Mai 2024 in Berlin.