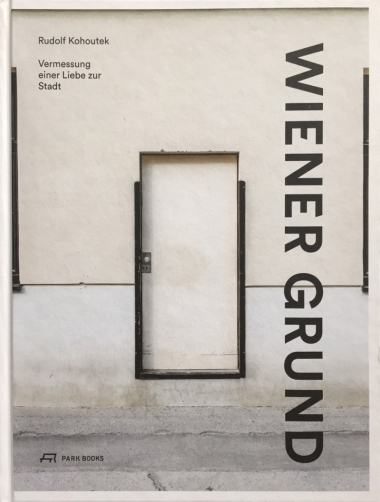Der Branche die Tür öffnen und wieder ankoppeln an unser Verantwortungsgefühl
Die ArchitektInnen von „baubüro in situ“ realisieren nicht nur vorwiegend im Bestehenden, sondern setzen sich auch gemeinsam mit UnternehmenspartnerInnen für die Wiederverwendung von Materialien und Bauteilen ein. Im Interview mit Kerstin Müller sprachen wir über aktuelle und zukünftige Pionierarbeit beim Bauen im Bestand..
Frau Müller, woran arbeiten Sie und Ihr Büro zurzeit?
Kerstin Müller: Nach wie vor liegt unser Schwerpunkt in Umbauarbeiten. Vermehrt schauen wir darüber hinaus auf den Einsatz von wiederverwendbaren Bauteilen. Da haben wir ja bereits schon einige Beispiele realisiert, wie zum Beispiel „Kopfbau Halle 118“ in Winterthur (DBZ 7-8 | 2021). Jetzt gehen wir aber ein paar Schritte weiter. In Basel beispielsweise will die Christoph Merian Stiftung ein mehrgeschossiges Parkhaus in Stahlbau zum Rückbau und zur Wiederverwendung der Materialien in Auftrag geben. Anhand dieses Beispiels sollen verschiedene (digitale) Szenarien durchgeführt und geprüft werden, in welcher Quantität und welcher Qualität beispielsweise die Stahlträger vorhanden sind. Im zweiten Schritt würden wir gerne schauen, ob wir die wiedereinsetzbaren Bauteile in eigenen Projekten einsetzen oder über Zirkular, als FachplanerInnen für nachhaltiges Bauen, an andere Büros vermitteln können. Bei diesem Projekt ist auch der Schweizer Dachverband der Stahl-, Metall- und Fassadenbauweise dabei, weil der Verband die Notwendigkeit der Wiederverwendung erkannt hat und offen ist für neue Ansätze. Ich finde das natürlich super, weil solche Themen genau an diese Stellen gehören. Die Wertschöpfung sollte man bei den Branchen belassen, weil gerade dort das Expertenwissen liegt für den Rückbau, für die Evaluation, für die Anpassung und den Wiederaufbau der Bauteile. Aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Weg, um Branchen mit in die Veränderungen einzubringen, sodass sie die neuen Wege nicht blockieren oder mit einer Lobby dagegen vorgehen werden. Das ist der Weg, den wir versuchen.
Das Andere, woran wir momentan arbeiten, ist ein Workshop, in dem es um Hochhäuser in Beton aus den 1960er- und 1970er-Jahren geht, die abgerissen werden. Dort machen wir eine Studie mit der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), die bereits für den Stahlbau Algorithmen entwickelt hat, mit denen man neue Tragwerke entwickeln kann, zwischen denen die PlanerInnen dann wählen können. Dieses theoretische Konzept wird in Basel jetzt zum ersten Mal umgesetzt. Das Elektrizitätsmuseum ist zurzeit in Bau und wird mit Stahlträgern von rückgebauten Strommasten errichtet. Nun hat sich die EPFL als zweiten Ansatz das Wiederverwerten von Betonteilen zum Ziel gesetzt. In unserem gemeinsamen Workshop wollen wir herausfinden, wie und ob man Betonteile weiternutzen kann. Das heißt, wie tief ist die Karbonatisierung in Probe-stücken vorgedrungen, wie hoch ist noch die Überdeckung des Stahls und wie könnte man die Elemente zu etwas Neuem fügen? In dem Team sind Ingenieure, kreative Köpfe und Hidden Champions, wie Dr. Angelika Mettke von der Universität Cottbus und Leute von der Stadt Zürich. Von der Stadt wird das Projekt auch finanziert. Im zweiten Teil werden wir versuchen, unsere Studien auf konkrete Gebäude in der Stadt Zürich zu übertragen.
Geht es dabei auch um eine Normierung?
Vor wenigen Tagen gab es von der sia (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein) eine Re-use-Tagung genau zu dem Thema. Dort ging es darum, dass die Normierung dem Kreislaufgedanken zuwiderläuft und wo Handlungsbedarf besteht. An der Tagung haben unter anderem Experten zum Brandschutz und zum Baurecht teilgenommen, weil das zum Teil komplettes Neuland ist: Wie setzt man Bauteile ein, wie schreibt man die Dinge aus, wem gehört das Material wann …? Gehört es dem ursprünglichen Eigentümer oder schon dem Neuen oder doch dem Abbruchunternehmen oder dem, der es transportiert …?
Das ist alles noch offen und wir sind da involviert in einen Innosuisse-Antrag, der die rechtlichen Grundlagen aufzuarbeiten versucht. Das Ziel ist, dass man Verträge als Vorlagen aufsetzt, die dann in die Branche können. Ich bin auch im Verein Cirkla engagiert – dem Dachverband zur Wiederverwendung im Bauwesen in der Schweiz. Über den könnte man solche Vorlagen auch zur Verfügung stellen. Meine Hoffnung wäre noch, dass wir eine Vorlage finden, aufgrund der eine Versicherung solche Prozesse versichert.
Beim Kongress „Zukunft des Bauens“ sprach man auch von einer Verleihung der Materialien, die nach Gebrauch wieder zum Hersteller zurückkommen, um dann – nach Begutachtung, Einschätzung und Anpassung – in eine neue Schleife des Kreislaufgedankens geführt zu werden. Was halten Sie davon?
Für Möbel und eher kurzweilige Gegenstände gibt es das ja bereits. Aus meiner Sicht muss man aufpassen, dass man keinen Rebound-Effekt erzeugt. Bei Baumaterialien hat man sehr lange Zyklen, wo man sich beispielsweise fragen muss, wie lange es das Unternehmen geben wird, das mir das Material verliehen hat.
Sollen Projekten, wie dem angesprochenen Parkhaus in Basel, ausschließlich als Materiallager dienen oder spielt auch der Gedanke der Umnutzung eine Rolle?
Es ist ganz klar, dass die Umnutzung von Gebäuden an erster Stelle steht. Dass man Bauteile wiederverwendet, ist die zweite Schleife. Im Fall des Parkhauses geht es darum, dass ein Stück Stadt weiterentwickelt wird und das besagte Gebäude an der „falschen“ Stelle steht. Und klar: Das sind „hohe Rösser“, von denen wir herunterkommen müssen!
Gemeinsam mit Industriepartnern an zukunftsgewandten, nachhaltigen Themen zu arbeiten, ist Ihnen offenbar sehr wichtig. Steckt da auch eine Forderung hinter?
Die Industrie kümmert sich bereits oder sollte sich kümmern. Ich meine, ein wirtschaftliches Unternehmen wird neue Wege erst gehen, wenn es Überlebenschancen mit den neuen Geschäftsmodellen sieht. Ich glaube, sowohl auf der Seite der Industrie als auch auf Seiten der KollegInnen bewegt sich viel. Andererseits merken wir es bei Zirkular schon, dass, wenn wir andere Büros beraten und als Fachplanung hintenanstehen, es zum Teil schwierig ist, klarzukommen, weil manche Leute sich keinen Zentimeter bewegen. Man hängt hinter den Büros, die die Entscheidungshoheit haben und Empfehlungen abgeben an die Bauherrschaft. Und dann geht es manchmal um Fragen, ob der Farbton jetzt mittel- oder doch ein bisschen andersgrau sein soll. Und damit steht und fällt dann die Entscheidung, ob ich ein Trapezblech nehme oder nicht?! Manchmal ist es wirklich erschreckend, wie wenig Bereitschaft da ist, sich zu bewegen und sich der Frage der Klimakrise anzunehmen, die ja eigentlich unsere Hauptaufgabe ist als Architekturschaffende – und zwar jetzt! Das ist unsere Aufgabe, die wir lösen müssen. Und das man sich dem so gar nicht annimmt und stattdessen so widersetzt, finde ich unfassbar! Auch das Thema mit der Lehre: Was bringen wir denn jetzt den Jungen bei? Was wird ihre Aufgabe sein? Aufgabenstellungen von Museen als Neubauten erscheinen sinnlos! Ich meine, wer wird das denn machen in Zukunft? Die Aufgaben, die kommen, sind das Weiterbauen am Bestand, vielleicht das Verkleinern von Grundrissen. Bei der sia-Tagung wurde gesagt: In der Schweiz leben 8 Mio. EinwohnerInnen, prognostiziert ist ein Zuwachs auf 10 Mio. Eigentlich, wenn man die Grundfläche pro Person von 46 auf 37 m2 senkt, dann brauchen wir nicht neu zu bauen für diese Menschen. Solche Themen sind die eigentlichen Aufgaben, an die man die neuen Generationen heranführen muss. Wie können wir den Bestand so umbauen, dass wir mit einem möglichst minimalen Fußabdruck agieren? Wir sehen an uns selbst, dass wir dazu unser ganzes Denken ändern müssen. Das sind die wichtigen Aufgaben, die wir an den Hochschulen platzieren müssen. Nicht mehr das Neubauen von hübschen Dingen, die vielleicht, wenn es hochkommt, noch die Effizienz im Betrieb anschauen, aber eine komplette Leseschwäche bei allem haben, was das Material angeht. Manchmal denke ich, wir sind komplett entkoppelt von unserem Verantwortungsgefühl dafür, wo die Materialien herkommen, mit denen wir arbeiten. Und was eigentlich mit den Gebäuden geschieht, wenn wir sie abreißen, weil wir denken, wir müssten da jetzt einen nachhaltigen Neubau hinstellen. Wir sind komplett entkoppelt von der Realität! Wir dürfen diese Aufgabe nicht nur den heranwachsenden Generationen zuschieben, denn dann schieben wir auch die Verantwortung wieder weg. Nein, das müssen wir heute machen bei allen, die heute im Beruf stehen. Darin sehen auch wir unsere Aufgabe: Dieses Thema an Verantwortliche heranzutragen. Mit Zirkular sind wir dabei, mit Zürich einen Wettbewerb zu organisieren, bei dem die Stadt in die Verantwortung geht und Materialien von ihren eigenen Rückbauten wieder einsetzen möchte. Gemeinsam überlegen wir, wie ein solcher Wettbewerb aussehen kann. Da muss a) die Jury geschult sein, weil sie verstehen muss, was sie da eigentlich bewertet. Und b) müsste man eigentlich auch die Teams am Anfang schulen und denen während des Wettbewerbs vielleicht nochmal zur Hand gehen dürfen. Mit einem solchen Wettbewerb kann man direkt etwa zehn Parteien schulen, auch die, die heute entscheiden.
Lokales Material bedeutet nicht nur der Wald vor Ort. Lokales Material ist auch das verbaute Material, das vor Ort zur Verfügung steht. 500 kg Material pro SchweizerIn geht jährlich nicht in einen Kreislauf zurück. Das sind unfassbare Mengen, die wir verbrennen oder deponieren. Das spannende am Bauen ist doch, dass es immer mehr zu einem Gemeinschaftsprojekt wird. Ich mach ja keinen Masterplan und stelle dann fest: Upps, das braucht ja kein Mensch! Es geht doch darum zu sehen, was vorhanden ist und was an Veränderung daran überhaupt notwendig ist. Kleine, punktuelle Eingriffe sind dann oft die richtige Antwort. Ähnlich ist es mit wiederverwendbarem Material: Handwerker sind oft die Experten für Material. Man kann mit denen zusammen Lösungen erarbeiten, weil sie wissen, was geht und was nicht. Am Anfang ist da oft eine Skepsis, aber wenn sie dann das Material sehen, dann haben sie oftmals keine Sorge mehr, die Dinge einzubauen.
Zum Schluss ein Aufruf für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass wir alle die Klimathematik wirklich ernst, mutig und kreativ nehmen, in der Dringlichkeit, die sie hat. Und dass wir alle in unserem jeweiligen möglichen Rahmen und genau da wo wir stehen schauen, wie wir dazu beitragen können. Und das wir versuchen, Teil der Lösung zu sein und aufhören, die Verantwortung abzuschieben. Es ist unserer Zeit und unsere Aufgabe, die mit ihren neuen Themen und Berufsfeldern unglaublich spannend ist und Spaß macht!