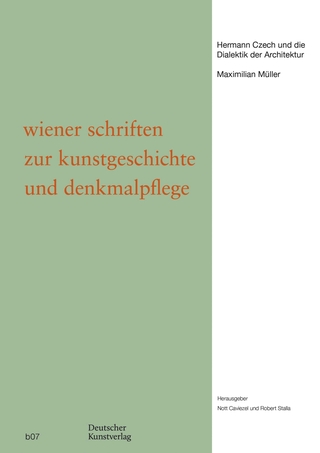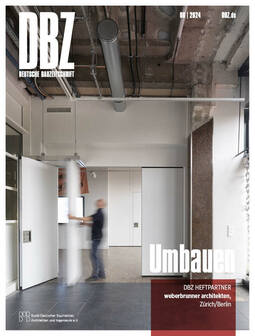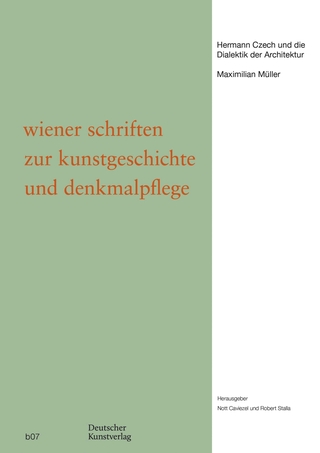
Hermann Czech ist ein schwieriger Mensch, und zugleich ein sehr sympathisch, empathisch offener. Dass das so ist, hat er möglicherweise seinen Wiener Wurzeln zu verdanken, auch seinem Verwurzeltsein in dieser abgelegenen, wie immer überraschend präsenten (jedenfalls in jedem akademischen Diskurs) Metropole.
Warum ich nun den Architekten, den zu treffen und zu sprechen ich vor Jahren das Glück hatte, immer noch und vor allem mit seinem „Kleinen Café“ verbinde, liegt einerseits an der ausführlichen Rezeption dieser Arbeit, die, so Dietmar Steiner, damals Direktor des Az W, „stellvertretend für alle Wiener Architekturneurosen“ sei. Andererseits liegt es an Czechs Zurückhaltung seinem eigenen Werk gegenüber, das er finden lassen will und niemandem aufdrängt: „Architektur ist nicht das Leben, Architektur ist Hintergrund.“
Nun hat sich Maximilian Müller dankenswerter Weise aufgemacht, das intensive Nachdenken Hermann Czechs auf dessen Werk zurückzubinden – ein Nachdenken übrigens, das auch ein anstrengendes und zugleich sehr anregendes, kritisches Analysieren bestehender und wenig hinterfragter Architektenübungen war und noch ist. Der Autor bedient sich dabei des dialektischen Prinzips „These/Antithese/Synthese“, einem Prinzip, dem auch der Architekt im eigenen Denken nahesteht. Und wirklich erscheint der Untersuchungsaufbau „These/Antithese“ bezogen auf die Heterogenität und Widersprüchlichkeit im gebauten wie auch schriftlichen Werk als zielführend. Die Diskussionen zu seinen Arbeiten zwischen den Begriffspaaren Übermut/Unterschätzung, Konsumtion/Produktion, Kunstwerk/Gebrauchsgegenstand, Manierismus/Partizipation, Subjektivität/Objektivität und Alt/Neu (was letzteres an die Analoge Architektur von Miroslav Šik erinnert) ergeben immer wieder sich fein kreuzende, miteinander verknüpfte (rote) Fäden, die allerdings spätestens im mit „Resümee“ bezeichneten Schlusskapitel noch einmal entknotet und auf wesentliche Aspekte reduziert werden: das Ambivalente als natürliche Grundhaltung des Architekten, Pragmatismus, Kunst als Korrektiv, Individualität (wenn sie angemessen ist!) und Alles Bauen ist Umbau.
So theoretisch und mit bestem Grundwissen für ein anderes Verständnis gestärkt, sollten wir die grundsätzliche Monografie von Eva Kuss (2018) noch einmal aus dem Regal ziehen und neu zu lesen beginnen. Und/oder nach Wien reisen, nicht bloß ins Kleine Café, aber auch! Be. K.
Maximilian Müller, Hermann Czech und die Dialektik der Architektur (=Bd. 7 Wiener Schriften zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege, hrsg. v. N. Caviezel, R. Stalla), Deutscher Kunstverlag, Berlin 2024, 184 S., 102 Farbabb.34, 90 €, ISBN 978-3-422-80225-4