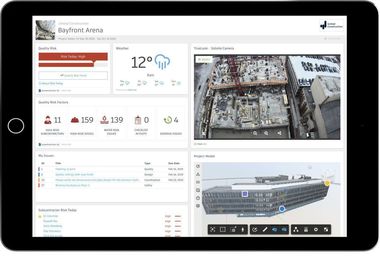Mapping als Praxis der Raumproduktion
Dagmar Pelger unterrichtet als Gastprofessorin in Kassel am Fachgebiet Nachhaltige Städte und Gemeinden und ist Teil der Architektur-und Planungskooperative coopdisco.
Im Interview sprachen wir über die Bedeutung von Orten in der Stadt, die einen Beitrag zum Geheimwohl beitragen.
Frau Pelger, in Ihrer Forschung nutzen Sie seit langem die Praxis des Mappings, um die Stadt und Orte der Gemeinschaft zu erforschen. Mit welchen Fragen treten Sie an die Karten heran? Geht es darum, „common spaces“ zu verorten?
Ich nutze das Mapping tatsächlich selbst, um herauszufinden, was common spaces sind. Seit zehn Jahren wird der Begriff viel diskutiert und ist inflationär in Gebrauch. Mich hat diese Vereinnahmung gestört, dass alles zum common space wird. Zum Mapping gekommen bin ich über ein Projekt an einer Universität in Belgien, wo das Mapping ganz gezielt als Analysewerkzeug eingesetzt wurde. Im Projekt „The Future Commons 2070“ haben wir eine Karte von der südlichen Nordsee gezeichnet und diese als ein „commons“ beschrieben. Ich habe etwas gebraucht, bis ich verstanden habe, dass dem Begriff das deutsche Wort „Gemeingut“ bzw. „Allmende“ entspricht. Meine erste Kartierung war also die einer wünschenswerten maritimen Raumplanung, bei der die See nicht in unterschiedliche Wirtschaftsbereiche aufgeteilt wird, sondern ein Gemeingut ist. In Berlin habe ich dann am Chair for Urban Design and Urbanization (CUD) von Jörg Stollmann kartografisch gearbeitet. Mit Studierenden haben wir dort angefangen, die Stadt als potenzielles Gemeingut zu zeichnen. Wir haben Spuren von Räumen nachgezeichnet, die als Gemeingut gesehen werden können, die weder eindeutig privat noch öffentlich sind, sondern von verschiedenen Nutzer:innen angeeignet und gepflegt werden. Diese Orte haben die Kraft, eine vergemeinschaftende Raumproduktion zu etablieren.

„A fem*MAP 2049“ ist ein Projekt des Fachgebiets für Städtebau und Urbanisierung der TU Berlin und entstand 2020 unter der Leitung von Julia Köpper, Dagmar Pelger, Martha Wegewitz und Jörg Stollmann
Foto: CUD/ Dagmar Pelger
Wie definieren sich also als Gemeingut geltende Räume?
Wir haben begriffen, dass eine Aussage des Philosophen Lieven de Cauter dafür hilfreich ist. Denn er unterscheidet zwischen „universal spatial commons“ und „particular spatial commons“. Ein universelles Gemeingut wäre beispielsweise Sprache oder Kultur. Die spezifischen Gemeingüter hingegen existieren nur, solange die Gemeinschaft sie in ihrer Praxis aufrechterhält. Wenn ich beispielsweise eine Demonstration organisiere, dann entsteht für diesen Zeitraum ein Raum, der sich aus der dichotomen Spaltung von Öffentlich und Privat löst und einen dritten Raum eröffnet. Der dritte Raum ist eine beliebte Beschreibung für die commons. In den Wirtschaftswissenschaften wird sogar noch eine vierte Sphäre definiert, die sogenanten „club goods“. Damit haben sie erkannt, dass es auch Gemeinschaften gibt, die exklusiv Räume eröffnen, die weder öffentlich noch privat sind. Es passiert ganz oft, dass exklusive, abschöpfende Gemeinschaften sich bestimmte Räume aneignen und eben nicht für andere zugänglich machen. Das sind die gated communities dieser Welt, die ganz oft als „commons“ bezeichnet werden, obwohl sie das nicht sind. Das zu erkennen, war der Schlüssel für meine eigene Forschungsfrage, der ich in meiner 2022 erschienen Dissertation „Spatial Commons. Zur Vergemeinschaftung urbaner Räume“ nachgegangen bin.
 Im Mapping steht die geteilte Autor:innenschaft im Fokus und damit verbunden die Erkenntnis, dass nur in der gemeinsamen, kollektiven Arbeit gerechte Räume entstehen
Im Mapping steht die geteilte Autor:innenschaft im Fokus und damit verbunden die Erkenntnis, dass nur in der gemeinsamen, kollektiven Arbeit gerechte Räume entstehen
Foto: Dagmar Pelger
Wie konkret sehen denn commons und clubs im Stadtraum aus? Und welche haben Sie an diese Orte gestellt?
Der Wrangelkiez ist ein gutes Beispiel. Meine Kollegin Anna Heilgmeir und ich haben mit Studierenden mit den Farben Schwarz und Weiß gearbeitet, um diese beiden Sphären deutlich zu machen. Wir haben hier also erstmal eine Straße, die per se öffentlich und aneignenbar ist und die von der öffentlichen Hand gepflegt wird. Daran anschließend der Raum von privaten Häusern, der erstmal verschlossen ist. Für die Erdgeschosszone, in denen sich Rautaschen in Läden öffnen, funktioniert diese Beschreibung nicht so gut. Um das zu klären, haben wir die Definitionsbausteine von commons genutzt. Wir haben Kriterien gefunden, wie beispielsweise die Höhe der Preise, ob ich mich da aufhalten darf, ob es einen Informationsaustausch gibt, ob sich die Betreiber:innen mit ihrer Nachbarschaft solidarisch verhalten oder sogar eine Zugänglichkeit über klassische Öffnungszeiten hinaus ermöglichen. Viele Shops versuchen allerdings, eine selektive Klientel anzuziehen. Wir haben kettenartige gewerbliche Zwischennutzungen beobachtet, mit denen Schritt für Schritt das Preisniveau angehoben wird, um die Immobilien aufzuwerten und über den Verkauf Gewinne abzuschöpfen. Wir haben also alle Läden, die einen Beitrag zum Alltag leisten, als Teil der hier in Weiß dargestellten Straße eingezeichnet. Die anderen haben wir im dunklen Schwarz des privaten Hauses belassen. An einer Stelle haben wir schwarze Zacken gezeichnet, weil da eine sehr starke Touristifizierung stattfindet.
 Die Kartierung entstand gemeinsam mit den Studierenden Juliana Garcia Leon, Jörn Gertenbach, Maximilian Hinz, Tildem Kirtak, Katrina Neelands Malinski, Natasha Nurul Annisa, Jessica Voth (TU Berlin), Peter Máthé, Anna Rodriguez Bisbicus, Lara Stöhlmacher (UDK Berlin)
Die Kartierung entstand gemeinsam mit den Studierenden Juliana Garcia Leon, Jörn Gertenbach, Maximilian Hinz, Tildem Kirtak, Katrina Neelands Malinski, Natasha Nurul Annisa, Jessica Voth (TU Berlin), Peter Máthé, Anna Rodriguez Bisbicus, Lara Stöhlmacher (UDK Berlin)
Foto: Dagmar Pelger
Handelt es sich mit diesen Darstellungen um einen Versuch, eine andere Geschichte der Stadt zu erzählen?
Über diese Kartierungsprozesse wurde die Frage nach dem Eigentum immer dringlicher. Es gibt im Städtebau teilweise nur ein oberflächiges Wissen dazu, wie Gentrifizierungsprozesse ablaufen. Es wird davon ausgegangen, dass der Mietpreis zur Verdrängung führt. Auf eine Art stimmt das, aber in dem Prozess der Suche nach Commons wurde deutlich, dass es eigentlich die Eigentumsverhältnisse sind, die das vorantreiben. Wir haben angefangen, Commons und Eigentumsverhältnisse in Karten einzuzeichnen. Dabei sind Farbmuster entstanden, die die Verteilung des Eigentums deutlich machen. Wenn man sich die Stadtgeschichte anschaut, ist es sehr interessant zu schauen, wem die großen stadtgeschichtlichen Meilensteine gehören: Wer hat denn Haussmann in Paris beauftragt? Wer hat Hobrecht in Berlin beauftragt? Und welche Eigentumsverhältnisse haben beide in diesen Stadtplanungen im 19. Jahrhundert etabliert? Das war in einem Fall Napoleon III., im anderen das Preußische Innenministerium. In Berlin war die Idee, dass Hobrecht nur ein Straßennetz planen sollte und die Kuchenstücke zwischen den Straßen von Investoren entwickelt werden. Das hat die Mietskaserne in ihrer hochverdichteten Form hervorgebracht, weil damit die Ausnutzung am besten war. Auch die innere Erschließung der sehr großen Parzellen wurde an die Investoren abgegeben.
Das heißt, es geht nicht nur um die Auffassung eines aktuellen Zustands auf der zweidimensionalen Karte, sondern auch um die Dimension der Zeit. Welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für die Commons?
In dem Rechercheprojekt „all you can read“ ging es genau darum, die Geschichte mitzulesen und dazu viele Quellen von Frauen hinzu zu ziehen. Daraus ergaben sich verschiedene Timelines, die uns ermöglichen, die Karten auch in der Ebene der Zeit zu denken. Dabei wurde deutlich, dass sich einerseits die Verwebungen in der Planungsgeschichte von Staat und Kapital durch die Geschichte ziehen, aber auch die geschichtliche Kontinuität in den Commons. Die Allmende war ursprünglich ein feudales Raumgebrauchssystem. Bauern erhielten im Grunde ein Stück nicht parzelliertes Land, um es vielfältig als Gemeingut zu nutzen. Es hat also sowohl die emanzipatorische vergemeinschaftete Herstellung von Raum eine weit zurückreichende Geschichte als auch die privatisierend, kapitalistisch ausbeutende Extraktive. Die Geschichte muss man nicht neu schreiben, mir war es aber wichtig, die versteckten Beispiele nach oben zu holen; und die anderen Beispiele, die als natürliche Urbanisierungsphänomene gelten, als große Errungenschaften der von Männern gestalteten Geschichte und die als Standard gesetzt werden, zu entlarven. Mit dem Farbcode und der Timeline kann die Geschichte ganz andere Dynamiken darstellen und die Architektinnen und Planerinnen dazu anregen, die Frage des Eigentums als Basis der Raumproduktion mitzudenken.
 Auch die Kartierung des Wrangelkiezes ist ein Projekt des Fachgebiets für Städtebau und Urbanisierung unter der Leitung von Anna Heilgemeir, Dagmar Pelger und Jörg Stollmann. Beteiligte Studierende waren Franziska Bittner, Nathalie Denstorff, Yannik Olmo Hake, Florian Hauss, Katharina Krempel, Nija-Maria Linke, Ana Martin Yuste, Mateusz Rej
Auch die Kartierung des Wrangelkiezes ist ein Projekt des Fachgebiets für Städtebau und Urbanisierung unter der Leitung von Anna Heilgemeir, Dagmar Pelger und Jörg Stollmann. Beteiligte Studierende waren Franziska Bittner, Nathalie Denstorff, Yannik Olmo Hake, Florian Hauss, Katharina Krempel, Nija-Maria Linke, Ana Martin Yuste, Mateusz Rej
Abb.: Dagmar Pelger
Warum braucht es die Darstellungsform der Karte?
Die Karte hilft mir, die durch Eigentumsverhältnisse hervorgebrachten Verräumlichungsmuster zu erkennen. Im Wrangelkiez lese ich die Straße plötzlich nicht mehr als lineares Element, sondern sie entwickelt Ausbuchtungen und bekommt eine Raumfigur, die in die privaten Häuser reinreicht, aber eben nur an diesen Stellen, an denen sich der Raum solidarisch öffnet. Wenn ich das einmal gezeichnet habe, werde ich dieses Bild nicht mehr los. Das Raumbild verändert sich nachhaltig.
Momentan sind Sie an der Universität Kassel tätig, wo Sie sich gerade auch mit der Stadt beschäftigen. Welche Fragen stellen sich hier im Vergleich zu Berlin?
Was mich an Kassel sehr fasziniert, sind die vielen soziokulturellen Aktionen. Das hängt einerseits ein bisschen mit dem Einfluss der Documenta zusammen, aber auch mit einer sehr progressiven Universitätsgeschichte; vor allem aber mit einer sehr machtvollen Rüstungsindustrie, die eine sehr konservative bürgerliche Stadtgesellschaft und auch eine sehr große migrantische Arbeiter:innnenschaft mit einer langen Geschichte impliziert. Die Frage der Ressourcenverteilung ist in Kassel sehr brisant und muss angegangen werden. Und das kennzeichnet ja auch Berlin Kreuzberg. Auch da haben wir einen migrantischen Bevölkerungsanteil, der in die Stadt einwirkt. Meine These wäre, dass diese diversen Prägungen der Stadtgesellschaft in der Stadtgesellschaft eine ganz spezifische soziale Praxis in der Stadt hervorbringen. Es gibt in Kassel immens viele Initiativen, die sehr agil sind und ein großartiges Programm machen.
Auf welchem Maßstab funktioniert denn das Mapping? Am Beispiel Wrangelkiez haben wir einen ganz kleinen Ausschnitt besprochen. Wie weit kann man mit diesem Werkzeug rauszoomen?
Kartografie ist ein geografisches Werkzeug, das versucht, Raum großmaßstäblich zu vermessen und sehr abstrakt fassbar zu machen. Was mich aber interessiert, ist das regionalplanerische Werkzeug, mit dem man versucht, Regionen als Raum greifbar zu machen, sie auf den Raum zu projizieren, in denen ich selbst drinstehe. Es gibt also einen ständigen Wechsel zwischen abstrakten Perspektiven und den konkreten Erlebnissen, die ich vor Ort mache. Es kommen also Geografie und Ethnografie zusammen. Diese Praxis hat in den letzten zehn Jahren, im Zuge der Kämpfe um urbane Ressourcen, einen massiven Einfluss auf die städtebauliche Maßstabsebene erhalten.
Welche Rolle spielt der eigene Körper, die eigene Position, während wir kartieren?
Der eigene Körper ist in die Raumproduktion, die ich versuche zu kartieren, integriert. Wir versuchen uns jedes Mal auch selbst in die Karte einzutragen. Bei einer Karte zur Berliner Mitte haben vier von unseren Studierenden draußen übernachtet. Sie haben sich mit ihren vier Schlafsäcken in die Karte eingetragen. Auch bei der fem*MAP hat sich der Projektraum alpha nova mit eingetragen. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass es keine neutrale Beobachter:in geben kann, weil wir den Raum mitherstellen, den wir kartieren. Und ich würde so weit gehen zu behaupten, dass es eine genuin nicht feministische, patriarchale Vorstellung in der klassischen Kartografie und Geografie von einer erhabenen Person gibt, die das von außen neutral beschreiben kann und die sich jeder Subjektivierung entzieht. Es ist die exakt entgegensetzte Haltung zu sagen, wir sind mittendrin, hier habe ich geschlafen und der Ort ist nicht mehr der gleiche. Dennoch muss ich nicht das Werkzeug der Karte loslassen. Man kann trotzdem eine georeferenzierte Übersicht zeichnen und sich in die normierten, patriarchalen, machtvollen Werkzeugkästen integrieren, um sie von innen heraus umzudrehen. Die Position des eigenen Körpers ist wichtig, aber auch die Art, wie gezeichnet wird. Für mich ist eine geteilte Autor:innenschaft wichtig, um auch Wissen, das ich von außen bekomme, anzuerkennen und zu integrieren.
Welche Rolle haben Kunsträume innerhalb des Konzeptes von commons?
Projekträume, wie die alpha nova & galerie futura, kann man als commons verstehen, weil sie das Begehren haben, die gemeinsame Praxis der Kunst in den Vordergrund zu stellen. Sie sind selbstverwaltet und damit weder öffentlich noch privatfinanziert. Séverine Marguin hat sich in ihrer Dissertation das Kommen und Gehen der Berliner Projekträume angeschaut. Wir haben dann gemeinsam eine Kartierung von den Projekträumen, die wirklich geschützte und zugängliche Räume für subkulturelle Kunst darstellen, vorgenommen. Das sind wirkliche dritte Räume für die Kunst. Es gibt diese Räume, aber die haben es immer schwieriger. Entweder sie verschwinden, weil es schlicht keine bezahlbare Räume mehr gibt, oder es fließt unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit in die Antragsstellung für öffentliche Gelder. Es war also die Suche nach einer spezifischen soziokulturellen Raumproduktion, die sich in der Kunst verortet, sich aber solidarisch in die Stadt öffnet.
Was hat es mit der fem*MAP auf sich, die in Zusammenarbeit mit der galerie futura entstanden ist?
Das Projekt entstand auf Initiative von Felicita Reuschling. Ihre Idee war, zu untersuchen, wie die Ausbildung von Frauen als Architektinnen und Planerinnen mit der tatsächlichen Stadtraumproduktion zusammenhängt. Es ging um Fürsorgearbeit und die Frage, wie wir als Frauen in der Stadt wohnen wollen und wie sich das an die Lehre rückkoppeln lässt. Dazu gab es dann die Ausstellung in der alpha nova. Anknüpfend an Dolores Hayden wurde die Frage nach der nicht sexistischen Stadt erneut gestellt. Wie könnte diese Stadt aussehen? Dazu haben wir dann im Mapping festgestellt, dass diese Stadt schon da ist.Wir müssen nur das an die Oberfläche holen, was an FLINTA Netzwerken existiert. In einem Seminar sind dazu einige Thesen erarbeitet. Es ging dabei um Themen wie die Repräsentation von FLINTA-Räumen, das Netzwerk von queer feministischen Räumen, um die Nacht als schwer zugänglichen Ort bzw. Zeitraum in der Stadt, verschiedene Formen der Sorgearbeit, die Rolle der Mobilität und der Wege aus der feministischen Perspektive und das Wohnen, wie auch die Wohnungssuche. All diese Themen haben wir in eine Karte übertragen. In Schwarz ist die Kartierung Berlins zu sehen, wie es ist. Die Räume der langen Wege, der nächtlichen Dunkelheit, Netzwerke der self empowerten Räume in schwarz. Für ein laut der Studierenden im Jahr 2049 stattfindendes dreitägiges Fem-Festival haben sie dann eine weitere Ebene in Rot hinzugefügt. Sie zieht sich wie ein Marsch durch die Stadt und stellt ihre Zukunftsvision für 2049 dar. Der Marsch führte an neuen Institutionen, neuen bezahlbaren Wohnungen oder auch an dem Mont Fermott von Dorothea Nold vorbei.
Die Karte wird also auch zur Basis für eine Vision?
Ja, genau das ist das Besondere am Mapping, weil die Art und Weise, wie ich auf das Heute schaue, mir das Material für das Morgen liefert. Dabei bleibt die Karte interpretationsoffen für diejenigen, die sich dann mit ihr auseinandersetzen. Jede Leser:in kann ihre eigene Lesart mit hineingeben und auch etwas anderes daraus machen. In der Architektur herrscht manchmal noch die Vorstellung, das Neue könnte aus einer Tabula rasa entstehen. Es ist aber ganz anders: Je genauer ich die Karte zeichne und damit wahrnehme, was mir wichtig ist und was nicht, desto deutlicher springt mir die Zukunft entgegen. Es ist eigentlich ganz einfach.
Interview: Natalie Scholder/DBZ