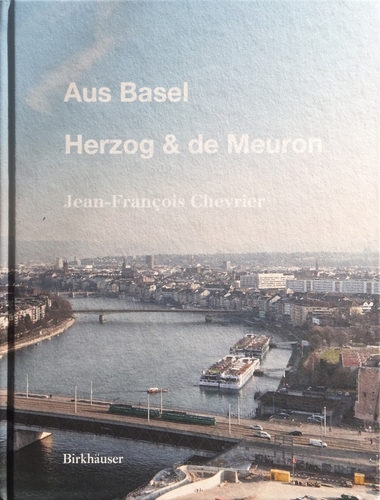Meret Oppenheim Hochhaus, Basel. Ein Skandal?
„Ein architektonisches Monstrum“ ist ein noch eher milder Ausdruck in der öffentlichen Diskussion darüber, was die Basler Architekten Herzog & de Meuron ihrer Stadt gerade an die Gleise gestellt haben: das Meret Oppenheim Hochhaus. Eine lokale Zeitung nutzte die Gelegenheit der gerade populären Antistimmung und lies in einer von ihr durchgeführten Umfrage das Wohnhochhaus südlich des Bahnhof SBB mehrheitlich zum „hässlichsten Gebäude der Stadt“ erklären.
Woher kommt diese Ablehnung nach dem langen Genehmigungsverfahren, das in der Schweiz immer auch plebiszitären Anspruch hat? Möglicherweise liegt es an der auch in der Schweiz heftig geführten Diskussion um mangelnden Wohnraum oder besser: um mangelnden bezahlbaren Wohnraum. Denn wenn man – vom Nachbarland Deutschland aus – sich zunächst überrascht die Augen reibt, dass mit dem Hochhaus ein paar tausend Quadratmeter Mietwohnraum in bester Lage bereitgestellt werden, kommt nach kurzem Blick in die Mietpreise gleich die Ernüchterung: zwischen ca. 32 €/m² und 34 €/m² sind zu zahlen, wer sich für eine der zwischen 40 m² und 227 m² großen Wohnungen entscheidet.
Daher die Ablehnung? 81 m hoch ist das nach der in Berlin geborenen und in Basel gestorbenen Künstlerin Meret Oppenheim benannte Hochhaus, ein gemischt genutztes Gebäude mit Wohnungen (6. bis 24. Geschoss), Büros (2. bis 5. Geschoss) und einem Café und Restaurant im EG. Diese – wie es die Architekten nennen – „Programmierung“ umfasst zudem in der 6., 7. und 15. Etage große Außenbereiche, die als Terrassen für die jeweiligen Wohnungen oder als gemeinschaftliche Außenversammlungsräume für die Büros dienen.
HdM wären nicht die, die sie geworden sind, wenn sie ihr „Programm“ schlicht geschossweise in einem senkrecht gestellten Quader untergebracht hätten. „Stapeln“ ist ihre Strategie, Volumen splitten ihre architektonische Taktik. Damit können Varianzen innen und auf der Oberfläche erzeugt werden. Binnenaußenräume und sogar komplette Leerstellen im Gesamtvolumen machen den Turm zu einer Vertikallandschaft. Die Balkonebene – in einem frühen Visual noch ohne die jetzt so umstrittenen Falt- und Schiebeladensysteme aus Aluminium – ist als klimatischer aber auch visueller Puffer definiert. Der Schleiereffekt ist tatsächlich eine Strategie, die HdM bereits mit dem SUVA Haus (1991–93) oder dem Wohn- und Geschäftshaus Schützenmattstraße (1992–1993, beide Basel) angewandt hatten und bis heute immer neu weiterdenken.
Auch ist das Hochhaus ein dominanter Baustein im Umbauprojekt „Südpark-Ensemble“, für das HdM 2002 den von der SBB organisierten Wettbewerb gewonnen hatten für zwei südlich des Hauptbahnhofs gelegenen Parzellen (zum ersten, bereits 2016 realisierten Baustein „Südpark Baufeld D“ s. DBZ 06|2016). Die beiden Neubauten fassen die 2003 fertig gestellte, die Gleisschneise querende Passerelle (Arch.: Cruz y Ortiz Arquitectos), die neben dem Zugang zu den Bahnsteigen vor allem die Basler Innenstadt mit dem Gundeldinger-Viertel (das „Gundeli“) verbinden. In Zukunft wird sich das Meret Oppenheim gewichtigeren Hochpunkten gegenüber sehen, drei jeweils 87 m hohen Türmen des „Nauentor“ genannten Gleisquerungsprojekts (Morger Partner Architekten). Gegen diese gab es Ende des vergangenen Jahres zahlreiche Einreichungen.
Basel wächst deutlich in die Höhe. Das Hochhaus von HdM hat da schon mal sehr sichtbar die Messlatte gesetzt, auch gestalterisch. Be. K.