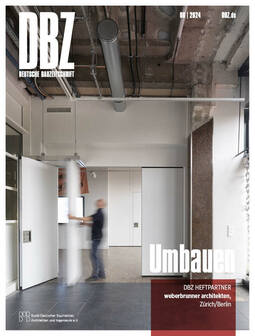Dem Material einen größeren Mitgestaltungsanteil einräumen
Im Allgäu, auf dem Gelände der LAGA24 Wangen, steht ein wunderbar verdrehter Holzturm (hier im Heft, S. 8) sowie ein Pavillon, dessen Tragwerk mit Flachs leistungsfähiger gemacht wurde. Was das Besondere dieser Bauten ist? Wir fragten den Architekten und den Ingenieur, deren Arbeiten wir seit langem mit großem Interesse verfolgen.
 Achim Menges (l.) und Jan Knippers
Achim Menges (l.) und Jan Knippers
Foto: Benedikt Kraft
Kleine Provokation zu Beginn: Wie lange wollt ihr noch auf Bundes- oder Landesgartenschauen aktiv sein, um einmal zu sagen: „Wir haben genug ausprobiert, jetzt gehen wir in die Praxis und machen gleich ein ganzes Stadtviertel“?
Achim Menges (AM) (lacht): Das ist wohl eher eine Frage der Gelegenheit als eine des Wollens!
Wer will denn da möglicherweise nicht?
AM: Unser Ziel ist es, neue Dinge zu entwickeln. Die Größe des Projekts spielt neben dem Innovationsgrad eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist uns, dass diese Entwicklungen Anwendung in der breiteren Baupraxis finden können. Unsere – wie du sie nennst - Gartenschauprojekte sind alle in knappen Budgetrahmen und in extrem knappen Zeiträumen geplant, gebaut und zertifiziert worden. Und das dank des Mutes der Bauherrschaft, die sich darauf eingelassen hat. Und zu deiner Provokation: Diese Fokussierung ist nicht ganz fair. Tatsächlich hatten wir an der Hochschule in Reutlingen mit dem Texoversum die Gelegenheit, unsere Forschung in einem größeren Bauwerk am Beispiel der Faserstrukturen zur Anwendung zu bringen. Wir arbeiten gerade in Stuttgart an einem Institutsgebäude, wo Vergleichbares realisiert wird. Du siehst, wir sind auf dem Weg aus den Gärten hinaus in die Städte!
Zentrales Stichwort beim Turm ist „Selbstformung“. Das erinnert an frühe Arbeiten von dir!
AM: Ja, die Methode der Selbstformung für gebogene Brettsperrhölzer mit relativ kleinen Radien ist tatsächlich aus der Forschung an responsiven Holzstrukturen hervorgegangen. Also Holzstrukturen, die sich mit der Veränderung der Witterung in ihrer Form verändern, was wir für sich selbst steuernde, „wetterfühlige“ Fassaden erforscht und kürzlich auch bei einem Bauprojekt für die Universität Freiburg zur dauerhaften Anwendung gebracht haben. Das wirklich Spannende an dieser Sache ist, dass die Selbstformung auch maßstabsübergreifend funktioniert. Was wir früher mit laminierten Holzfurnieren oder 4D-gedruckten Elementen mit Schichtstärken im Millimeter-Maßstab untersucht haben, funktioniert genauso für Brettsperrhölzer mit Lamellenstärken von 30 mm. Die genaue Anordnung der Faserrichtung mit dem Feuchtegehalt führen dazu, dass im Trocknungsprozess – den das Holz sowieso durchläuft – sich eine berechnete Krümmung einstellt. Das funktioniert so zuverlässig, dass man daraus einen Turm bauen kann, der mit Toleranzen im Millimeterbereich funktioniert.
Jan Knippers (JK): Der Holzbau hat sich in mehreren Schritten entwickelt, vom Balken zur Platte. Das war der Schritt, den wir um die Jahrtausendwende ungefähr gemacht haben mit der Erfindung von Brettsperrholz. Und jetzt kommen wir von der ebenen zur gekrümmten Platte, eine geometrische Dimension, die bisher dem Holzbau kaum zugänglich war. Im Betonbau gibt es die Schalen und Bogentragwerke, die auch im Stahlbau möglich sind. Mit der Selbstverformung machen wir dem Holzbau diese Dimension an Tragkonzepten zugänglich, wie zum Beispiel Sheddächer, Tonnendächer, Kappendecken. Röhrenförmige Elemente sind jetzt plötzlich einfach machbar. Ich denke da beispielsweise an die Unmengen von Beton- oder Stahlrohrschäften für die Windkraftanlagen, die man durch hölzerne Konstruktionen ersetzen könnte.
Der Vorgängerbau, der Urbach-Turm, ist für den Wangen-Turm konstruktiv für deutlich höhere Beanspruchungen weiterentwickelt und optimiert. Bei beiden Projekten verwenden wir die Krümmung der Platten, um durch die Profilierung eine Art Wellblech-Effekt zu erzielen und so dem Turmschaft zusätzliche Steifigkeit zu verleihen.
Das ist also noch nicht zu Ende gedacht … Ist die Platte einfach- oder mehrfachgekrümmt?
AM: So, wie die Platten im Moment zum Einsatz kommen, sind sie Zylinder- oder Kegelflächen, also einachsig gekrümmt. Trotzdem, und so verstehe ich deine Frage, erscheinen diese Objekte hochgradig dreidimensional. Um an Jan anzuschließen: Der Turm ist ein formaktives Flächentragwerk, das sich zum einen aus der Gesamtform als Hyperboloid einstellt und zum anderen durch die Oberflächenkrümmung der Brettsperrholzsegmente. Das alles konnten wir so im Raum arrangieren, dass es nachher auch zum tatsächlichen Holzformungsverhalten passt. Dass wir das heute darstellen und berechnen können, haben wir digitalen Technologien zu verdanken und so wird das inhärente Materialverhalten des Holzes nutzbar. In 4 000 Jahren Handwerkskunst wurde fast durchweg daran gearbeitet, die natürliche Selbstformung zu unterbinden, weil sie nur schwer zu kontrollieren war. Jetzt können wir das Materialverhalten für unsere Absichten nutzen, weil wir es bereits in den Entwurf und dann in die Planung integrieren können. Ich glaube, das ist es, was die Sache spannend macht.
Wie funktioniert die gezielte Selbstformung? Wie setze ich den Prozess in Gang, wie stoppe ich ihn?
AM: Wir arbeiten mit zwei Parametern: dem Faserverlauf in den Lamellen und deren Feuchtegehalt. Werden also zunächst Zweischichtplatten aus Lamellen mit unterschiedlicher Ausgangsfeuchte und orthogonaler Lamellenlage aufgebaut und dann auf die erwartbarte Feuchte im Betriebszustand getrocknet, stellt sich die präzise vorausberechnete Krümmung durch die Selbstformung ein. Das gekrümmte Brettsperrholz entsteht dann klassisch durch Laminieren von drei Zweischichtpaketen und einer abschließenden Sperrschicht als siebte Lamellenlage. Insofern ist eigentlich nur die Art und Weise, wie das Ganze in Form kommt, ungewöhnlich.
JK: Durch den symmetrischen Lagenaufbau erzeugen wir eine Formstabilität, die auch bei veränderten Feuchtigkeitsverhältnissen da ist. Ich war am Anfang auch skeptisch und dann überrascht, als sich beim Urbach Turm herausstellte, dass die selbstgeformten Brettsperrhölzer genauer wurden als die Teile, die mit mechanischer Kraft, ja Gewalt über eine Form gebogen worden sind. Was ganz klar daran liegt, dass bei der Selbstformung nicht über Rippen gebogen wurde und auch nicht irgendwelche Rückstellkräfte entstanden sind.
Wer ist in diese praktische Forschung involviert?
AM: Die Grundlagenforschung an selbstformendem Brettsperrholz liegt schon ein paar Jahre zurück und geht auf ein Gemeinschaftsprojekt mit der Professur für holzbasierte Materialien am Institut für Baustoffe der ETH Zürich beziehungsweise der Angewandten Holzforschung an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA und meinem Institut, dem Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung (ICD) an der Universität Stuttgart zurück, in das auch von Beginn an unser Industriepartner, Blumer Lehmann, involviert war. Der eigentliche Innovationsgrad für die Anwendung besteht darin zu wissen, mit wie wenig Parametern so exakt wie möglich simuliert werden kann. Klar, man könnte 120 Eingangsparameter rechnen, aber kann das ein Holzverarbeiter an seiner Maschine erfassen? Wir haben im Großen und Ganzen sechs in einem relativ einfachen Modell, das uns erlaubt, hinreichend zuverlässige Voraussagen zu machen. Zudem untersuchen wir am ICD derzeit die Anwendung von künstlicher Intelligenz, um präzise Voraussagen treffen zu können.
Wer finanziert ein solches Projekt?
AM: Die Stadt Wangen hat mit zusätzlichen Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg die bauliche Umsetzung des Projekts maßgeblich finanziert.
Das heißt, die Politik sieht hier ökonomische Vorteile … Dennoch die eindimensionale Frage: Haben wir auch als Gesellschaft etwas davon?
JK: Eine häufige Frage, sinnvoll oder nicht ... Wie bewertet man das, wer?! Gerade ist Beton so weit vorne, weil er billig ist und man immer noch nicht die ökologischen Kosten mit einpreist. Die Frage nach dem Sinn seriös zu beantworten, bedarf auch der Frage: Wo baue ich? Stichwort Regionalität.
Dann frage ich anders: Könnt ihr auch etwas anderes machen als einen schönen Aussichtsturm?
AM: Ja klar, zum Beispiel weitgespannte Dächer: Hier haben wir in jüngster Vergangenheit ein paar Projekte gehabt, beispielsweise ein 30 m weit spannendes Dach aus gekrümmtem Brettsperrholz. Wurde leider nicht realisiert, obwohl das Dach im Vergleich zu einer konventionellen Bauweise nicht wesentlich teuer war. Der Turm, über den wir sprechen, hätte aus konstruktiver Sicht auch wesentlich höher sein können. Die realisierten 23 m Höhe sind der Hochhaus-Richtlinie und den damit einhergehenden Brandschutzanforderungen geschuldet. Im Augenblick bauen wir weitgespannte Dächer aus eher – ich sage mal – „unangenehmen“ Baumaterialien, zum Beispiel irgendwelchen tiefen, massiven Trägersystemen, eingedeckt mit Trapezblechsandwich mit PU-Schaum-Kern … Es gibt schon erhebliche Einsatzgebiete.
Bevor ich euch auf den Holzturm fokussiere: Vor Ort steht noch ein zweites Projekt, in dem Flachs verwendet wird. Klingt einfach, ist es das auch?
AM: Vielleicht vorweg: Der Ansatz für unseren Pavillon ist eigentlich ganz ähnlich dem des Turms. Bei beiden Projekten werden althergebrachte, nachwachsende Baustoffe in neuen konstruktiven und herstellungstechnischen Kontexten aktiviert. Der Pavillon basiert auf der Erkenntnis, dass Holz zwar ein nachwachsender Rohstoff, aber auch eine rare Ressource ist, die wir durch wesentlich schneller nachwachsende Biomaterialien ergänzen können, wie zum Beispiel Flachsfasern.
JK: Wir müssen uns klarmachen, dass die Ressource Holz an vielen Stellen der Welt sehr selten und wertvoll ist. Nicht unbedingt im Voralpenland, aber schon hier, in England, wo ich aktuell bin. Im Pavillon ist die Spannweite 8,60 m, das würde ich mit einer normalen CLT-Platte gerade noch so schaffen. Aber diese Platte wäre zwischen 30 und 40 cm dick! Mit dem Einsatz der Faserkörper im hybriden Tragwerk können wir diese Stärke auf ca. 12 cm reduzieren, wahrscheinlich sogar auf 10 cm. Und: Die Flachsfasern sind eine günstige Pflanze …
Noch! Sie würde andere Pflanzen verdrängen, Raps, Mais oder Lein… Ist der Flachsanbau auch ein Mittel, um CO₂ zu binden?
JK: Aufgrund seiner geringen Masse speichert der Flachs nicht so viel CO₂ wie Holz. Trotzdem kann er eine ökologisch bedeutsame Alternative sein! Denn Flachs substituiert eben nicht nur die wertvolle Ressource Holz, sondern auch CO₂-intensive Konstruktionen aus Stahl oder Beton.
Regionales Produkt, regionale Fertigung: Ist das ein zentraler Punkt für euch?
AM: Ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Tatsächlich haben wir mit dem Pavillon das Ziel verfolgt, nur mit kleinen, lokal ansässigen Baubetrieben zusammenzuarbeiten. Um auch einmal zu zeigen, dass die Realisierung von innovativen Projekten nicht allein wenigen Global Playern vorbehalten ist. Vielleicht hatten wir ja auch besonderes Glück, aber uns war es eine große Freude, mit hochengagierten, lokalen Firmen diesen Bauprojekt zu realisieren.
Mit dabei waren ein lokaler Holzbauer, der u. a. auch das vorgefertigte Faserbauteil mit dem Holzbauteil gefügt hat, was im Sinne der Trennbarkeit über eine lösbare Verschraubung erfolgte. Die komplexen Fassadenkonstruktion haben ein lokaler Stahlbaubetrieb gemeinsam mit einer Fassadenfirma gefertigt, eine andere lokale Firma hat das Fundament aus Recyclingbeton mit CO₂-reduziertem Zement hergestellt, in das eine Bauteilaktivierung eingebracht ist. Ich würde sagen, dass sowohl der Turm als auch der Pavillon überhaupt so dort stehen, haben wir diesen handwerklichen Betrieben zu verdanken. Hier haben sich universitäre Forschung, digitale Planung und qualifiziertes Handwerk auf eine sehr produktive Art und Weise getroffen. Mit einer Vision dafür, was in der Architektur sehr bald passieren könnte.
Was haben wir vom selbstformenden Bauteil? Weniger Energie in der Fertigung? Ein – tragwerkstechnisch gesehen – optimiertes Bauteil?
JK: Beim schon genannten Urbach-Turm hatten wir den Vergleich mit herkömmlichen hergestellten Bauteilen, bei denen die Bretter über eine Art Spantengerüst mit sehr viel Kraft gebogen werden. Das hat dazu geführt, dass die Geometrie nicht 100 %ig passte, es gab Knicke, die mit Zeit- und Energieaufwand nachgearbeitet werden mussten. Im Gegensatz dazu ist die Selbstformung eine sehr elegante Methode, um mit wenig Energieaufwand zu fertigen, eben weil wir jetzt diese sehr präzisen Simulationsverfahren für die hygroskopische Selbstformung haben.
AM: Am Ende ist es ein Beitrag zu der übergeordneten Forschung, wie wir durch mehr Form mit weniger Material bauen können. Das ist schon ein wesentlich zukunftsfähigerer Ansatz als das im Bauen vorherrschende Paradigma, dass Form teuer und Material günstig ist, denn dies trifft nur auf die ökonomischen, nicht aber die ökologischen Kosten zu, wie Jan vorhin schon gesagt hat.
Wir sind gerade dabei, uns mit der tatsächlichen Anatomie von biobasierten Bauteilen zu befassen, was einen ganz anderen Zugang zu Materialien zulässt, um künftig viel effektiver zu planen. Das ist die methodische Innovation, der Sprung, weg von dem Verständnis, dass wir zuerst immer nur geometrisch planen, wie in den vergangenen Jahrhunderten, und erst danach kommt die Materialität. Unsere Forschung geht dahin, dass wir dem Material einen größeren Mitgestaltungsanteil einräumen.
Zum Schluss: Ihr beide arbeitet schon seit Jahrzehnten zusammen, geht das noch eine Weile? Da lachen sie beide.
JK: Was uns beide verbindet, ist eine ähnliche Vorstellung davon, was wir interessant und relevant finden, dass unsere Projekte sowohl als konstruktives wie architektonisches Objekt eine Qualität haben sollen, vielleicht sogar einen künstlerischen Anspruch, mit dem wir eine ingenieurwissenschaftliche, technische Innovation demonstrieren und evaluieren.
AM: Wir sind beide davon überzeugt, dass eigentlich alle unsere Arbeiten, unsere Bauten authentisch mit den Materialien umgehen, die sie zum Einsatz bringen und trotzdem immer wieder zu anderen Ergebnissen führen. Interessanterweise zielen wir dabei nicht auf eine gemeinsame Entwurfssprache, die wir etablieren wollen. Uns geht es darum, die Formsprache aus dem Material selbst herauszukitzeln, integrativ aus Konstruktion, Material, Struktur und Herstellung. Dadurch entstehen diese Bauwerke. Das ist es, was unsere Arbeit spannend macht, aus architektonischer Sicht und aus ingenieurswissenschaftlicher.
Mit dem Architekten Prof. Achim Menges und dem Bauingenieur Prof. Dr. Jan Knippers unterhielt sich DBZ-Redakteur Benedikt Kraft am 2. Mai 2024 vom Homeoffice aus.