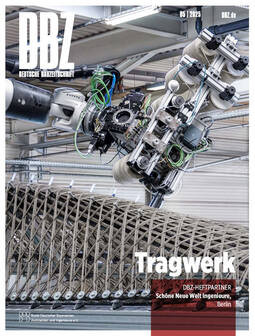„Im Sinne von Ungers“
Auf der Berliner Museumsinsel wird im großen Stil saniert. Das Pergamonmuseum muss bis 2037 teilweise geschlossen bleiben. Den damaligen Wettbewerb (2000) gewann O.M. Ungers. Nach seinem Tod wird sein Entwurf weiter ausgeführt – die Verantwortung musste jedoch weitergegeben werden. Für die Bauabschnitte A (zusammen mit BAL) und B hat sich das Büro Kleihues + Kleihues qualifiziert. Im Interview mit Jan Kleihues und Jörg Lenschow haben wir darüber gesprochen, was die Besonderheiten der Baustelle sind und wie sie den Entwurf von Ungers bewerten. Fest steht: Auch wo Ungers Idee nicht 1 : 1 umgesetzt werden kann, wird der Entwurf zweifelsohne „im Sinne Ungers“ ausgeführt, verspricht Jan Kleihues.
 Jan Kleihues (l.) und Jörg Lenschow
Jan Kleihues (l.) und Jörg Lenschow
Foto: Amina Ghisu/DBZ
Wie kam es dazu, dass Sie das Projekt nach dem Tod von Ungers übernommen haben?
Jan Kleihues (JK): Damals ist die Familie Ungers auf uns zugekommen. Sophia Ungers war der Meinung, wir wären die Richtigen, um das Projekt zu übernehmen. Bloß so einfach war das nicht. Es wurde ein europaweites Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Mit der Expertise von Walter Noebel und Jörg Lenschow, die lange mit Ungers gearbeitet haben, und gemeinsam mit BAL, bekamen wir dann den Zuschlag.
Jörg Lenschow (JL): Ungers Büro hat ein halbes Jahr nach seinem Tod den Entwurf, der schon fertig war, die Haushaltsunterlage Bau, abgegeben. Auf deren Grundlage entscheiden dann die Ministerien, ob das Projekt genehmigt wird. Dann war klar, dass das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, das BBR, als Bauherrenvertreter, die weitere Bearbeitung des Projektes neu vergeben wird.
Das heißt, Sie betreuen das Projekt seit…?
JL: …2009. Ich war bereits 1991 für Ungers Projekt- und später auch Büroleiter in Berlin und bin schon seit 2000 mit dem Projekt vertraut, als Ungers den Wettbewerb gewonnen hat. An dem Projekt haben wir in Berlin aber nur an Teilbereichen mitgearbeitet. Sonst wurde es hauptsächlich in Köln bearbeitet.
JK: Wie für den Bauabschnitt A gab es auch für den Bauabschnitt B ein europaweites Ausschreibungsverfahren. Wir dachten, wir hätten damals das Verfahren für die gesamte Maßnahme gewonnen. Es wurde dann aber entschieden, dass für den Bauabschnitt B nicht auf die alte HU-Bau zurückgegriffen werden kann, sondern eine neue Unterlage aufgestellt werden muss. Damit verbunden mussten dann auch die Architektenleistungen neu ausgeschrieben werden. Glücklicherweise konnten wir uns erneut qualifizieren, denn das Projekt muss aus einer Hand weitergeführt werden.
Sie haben den Entwurf von Ungers von 1 : 200 in den 1 : 1-Maßstab übersetzt. Was hat sich geändert?
JK: Vielleicht müssen wir noch etwas zu der Namensgebung des Projektbüros sagen. Wir haben uns für den ersten Bauabschnitt ganz bewusst Werkgemeinschaft Pergamon genannt, weil wir nicht wollten, dass unser Name, also der von Kleihues + Kleihues und BAL, wichtiger ist als der von Ungers. Das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen: Das Ziel war von Anfang an, das Projekt im Sinne Ungers umzusetzen. Natürlich kamen dann noch genehmigungstechnische Themen und der Denkmalschutz hinzu, sodass der Entwurf nicht eins zu eins umgesetzt werden konnte.
JL: Als wir den Entwurf 2009 übernommen haben, hatten wir eine ganze Reihe an Anforderungen vom Nutzer bekommen, die noch angepasst werden sollten. Eine wesentliche Forderung vom Denkmalschutz war, dass es mehr Substanzerhalt geben sollte. Ungers hatte in seinem Entwurf eine archäologische Promenade geplant, die unterhalb des Nord- und Südflügels große Ausstellungsräume vorsah – mit der Konsequenz, dass die Gewölbekonstruktionen unter der eingebauten Kunst, wie das Markttor von Milet und das Ischtar-Tor, abgebrochen und durch Neubaukonstruktionen hätten ersetzt werden müssen. Wir haben vom Denkmalpflegeamt die Auflage bekommen, die Gewölbekonstruktion zu erhalten. Das war ein sehr wesentlicher Eingriff.
Wie bewerten Sie den Entwurf von Ungers?
JK: Ich konnte mich anfangs nicht wirklich mit dem Entwurf anfreunden. Ich fand ihn sehr spröde. Aber je länger man daran arbeitet und sieht, wie viele Architekturmoden kommen und gehen, denke ich, dass das ein wirklich zeitloses und funktional richtiges Konzept ist. Diese Qualitäten kann man im bereits fertigen Nordflügel sehen: Der Stein für den Neubau wird der gleiche wie der an den Bestandsfassaden sein. Es wird keinen Materialwechsel geben. Der Bau wird aufregend, aber nicht aufgeregt.
JL: Ungers hat den Entwurf von Messel eindeutig aufgegriffen. Die Bauteile, die in den 1920er-Jahren nicht realisiert wurden – das Museum wurde 1930 eröffnet – hat Ungers in seinem Entwurf weiterentwickelt. Dafür hat er ein neues Tempietto als Eingangshalle für die antiken Sammlungen konzipiert. Den Kolonnaden-Bau, den Messel vorgeschlagen hatte, hat er zu einem Ausstellungsgebäude als vierten Flügel weiterentwickelt. Mit dem so vollendeten chronologischen Rundgang wird man durch die Höhepunkte der Weltarchitektur der letzten 4 000 Jahre gehen.
JK: Es ist natürlich toll, wenn man von außen schon sieht, was drinnen steht. Das hat man bei Museumsbauten nicht oft. Eine städtische Vitrine, an der man vorbeiläuft und denkt: „Da will ich unbedingt mal rein, das will ich sehen.“
Wie zeigt sich Ihr Einfluss auf den Entwurf?
JK: Es sind kleine Details, die sich geändert haben: Fußbodenbeläge, Türzargen, Wandfarben, neue Treppenhäuser. Im Tempietto haben wir die Treppe angepasst. Im Wesentlichen ist er aber so geblieben. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass gerade bei den Neubauten der Entwurf von Ungers 1 : 1 umgesetzt wird.
JL: Die Änderungen kommen daher, dass es von Außen Einflüsse gab. Es gibt jetzt Anforderungen an die Nachhaltigkeit und bei den Neubauten müssen höhere Energieeinsparungswerte erzielt werden. Deswegen haben wir nachträglich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und einen verfahrbaren Sonnenschutz an der südlichen Fassade des vierten Flügels geplant.
Als das Museum 1930 eröffnet wurde, waren Themen wie Barrierefreiheit noch nicht Schwerpunkte in der Planung. Wie wird das Thema heute in ein Gebäude integriert, das sich der Öffentlichkeit mehr öffnen möchte?
JK: Das ganze Gebäude ist perforiert und wir haben es mit extrem dicken Wänden zu tun. Teilweise haben wir diese für die Aufzüge durchbrochen. Es gibt zudem große Niveauunterschiede, z. B. zwischen Miletsaal und Prozessionsstraße. Auch die Aufzüge in den Brückenköpfen am Kupfergraben waren in Ungers Entwurf nicht enthalten.
JL: Früher gab es im ganzen Haus nur drei Aufzüge, von denen zwei immer kaputt waren. Künftig werden wir 18 haben.
Neben dem Pergamon wurde 2019 die James-Simon-Galerie eröffnet. Wie positioniert sich das Museum innerhalb des sich verändernden Kontextes der Museumsinsel und welche Rolle spielt die Archäologische Promenade dabei?
JK: Eigentlich sollte man nicht über das neue Eingangsgebäude ins Pergamonmuseum eintreten, sondern vom Kupfergraben über das Tempietto. Aber ich denke, das wird auch wieder so kommen.
JL: Die Staatlichen Museen wollten mit der James-Simon-Galerie Flächen haben, in denen Wechselausstellungen stattfinden können. Zur Museumsinsel gab es schon mehrere Anläufe und Wettbewerbe – der erste wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Messel gewonnen. Dann gab es die Wettbewerbe ab 1990: Der Entwurf von Frank Gehry z. B. sah große gläserne Verbindungsbauten zwischen den Museen vor. Diese brauchen wir aber gar nicht. Die Museen sprechen für sich. Ich denke, es ist gut ausgegangen für die Museumsinsel, denn die Solitäre bleiben weiterhin erkennbar und die Verbindung der Museen untereinander wurde so angeordnet, dass sie das schöne bauliche Bild nicht verändert.
JK: Mit der Promenade wollen wir nicht, dass man durch einen Tunnel läuft: Es gibt immer wieder Momente, in denen man Licht von oben sieht und in einem anderen Museum auftaucht. Das sind Verbindungsbauwerke zwischen Bode- und Pergamonmuseum über die James-Simon-Galerie bis zum Neuen und Alten Museum. Ich denke, das wird sehr gut funktionieren. Gerade ist es nicht möglich, um das Pergamon herum bis zur Alten Nationalgalerie zu laufen. Wenn aber die geplante Fußgängerbrücke fertiggestellt ist, wird der Weg bis zu den Kolonnaden möglich. Das sind öffentliche Räume mit einer fantastischen Qualität direkt am Wasser und an den Museen vorbei. Ich würde mir wünschen, dass das so kommt. So sicher ist es noch nicht.
Wie integriert sich das Projekt in diese Außenanlagen?
JL: Die restlichen Bereiche, geplant von Levin Monsigny, können erst fertiggestellt werden, wenn das Pergamonmuseum steht. Die Verbindungsbauten der Promenade befinden sich unterhalb dieser Außenanlagen.
JK: Was man manchmal vergisst, ist, dass die S-Bahn einfach zwischen zwei Museen durchrattert. Das ist eine spezieller urbaner Kontext. Die jetzt aktuell unwirtlich erscheinende Situation wird sich durch unsere Intervention verbessern.
Bei einer geplanten Bauzeit von 12 Jahren scheinen bei diesem Bauabschnitt viele Unwägbarkeiten mit einberechnet zu sein.
JL: Wenn man über die langen Zeiträume der Baustelle spricht, muss man bedenken, dass wir es mit einer extrem schwierigen Baustellensituation zu tun haben. Während der Kranarbeiten für die Gesimssanierung und die Dachträgereinbringung konnte nur in bestimmten Zeitfenstern, wenn keine Züge fuhren, gearbeitet werden. Ein anderes Beispiel: Zurzeit haben wir als Dachdeckung nur Drahtglas, das wird durch schweres Isolierglas ersetzt. Wir müssen den ganzen Dachbelag abräumen, die Dachtragwerke verstärken und die Lichtdecken komplett erneuern. Die ganze Kunst, die im Haus bleibt, wird während der Bauzeit im Freien stehen und muss durch mobile Wetterschutzflächen geschützt werden. Das ist keine gewöhnliche Baustelle, sondern eine mit extrem hohen Anforderungen.
Wo sehen Sie mögliche Schwierigkeiten im Prozess?
JL: Der Bauabschnitt B des Pergamonmuseums ist die letzte Baustelle, die wir noch auf der Museumsinsel haben – drum herum wurden alle Museen schon instandgesetzt. Was das Pergamon betrifft, haben wir im Bauabschnitt A sehr gute Erfahrungen gesammelt. Aufgrund dessen ist das Projekt sehr gut aufgestellt und es sind alle Eventualitäten jetzt schon bedacht worden. Es finden zurzeit noch Bestandsuntersuchungen statt, die noch für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Das wird sich aber für die Außenstehenden gestalterisch nicht bemerkbar machen, wenn wir dann eine planerische Lösung entwickeln. Wir versuchen natürlich, den Entwurf, den wir im Jahr 2022 abgegeben haben und der von den Ministerien mit Budget und Zeitplan bestätigt wurde, so auszuführen.
Anforderungen, z. B. an Nachhaltigkeit, könnten sich bei Fertigstellung bereits geändert haben…
JK: Es gibt nichts Solideres als ein solches Gebäude, auch was Wärmespeicherung, Fensterflächenanteil usw. angeht. Man kann mehr Solarzellen einbauen oder Geothermie einsetzen. Entscheidend ist jedoch, dass das Gebäude selbst so robust ist, dass man diese Dinge nicht braucht. Die Solarpaneele, die wir anbringen, machen zwar die Energiegewinnung nachhaltiger, sind jedoch nicht ein wesentlicher Aspekt der Gesamterneuerung des Gebäudes. Da sind andere Dinge wichtiger, die der Bestand schon mit sich bringt.
Das Thema ist natürlich in aller Munde und viele fragen sich, wieso der Bau so lange dauern muss. Auch wenn es nicht ganz in Ihrer Hand liegt, wie ändert sich Ihre Wahrnehmung des Projekts mit der langen Bauzeit?
JL: Wir sind mit dem Bauabschnitt B und der Vorentwurfsplanung im Jahr 2020 angetreten. Damals hieß es noch, Fertigstellung wäre im Jahr 2031. Das ist genau das Jahr, in dem ich normalerweise in Rente gehen würde. Nach der Überarbeitung der Terminplanung kam man zum Ergebnis, dass es baulich zwar 2033 fertig wird, aber mit den Inbetriebnahmeprozessen und mit dem Einrichten der Sammlungen wird die Eröffnung im Jahr 2037 erfolgen. Da habe ich auch erst gedacht: Um Gottes Willen, da muss ich ja noch sechs Jahre dranhängen! Das macht schon was mit Einem, denn es ist wirklich ein Marathonlauf. Und es ist so, als wäre man jetzt bei diesem Marathonlauf auf die Ziellinie geraten und dann sagt dir jemand, „bitte noch zehn Runden laufen“. Aber dadurch, dass der Bauabschnitt A bald fertig ist, die Räume so fantastisch werden und wir merken, dass wir den Menschen, damit eine sehr große Freude machen, steigt die Motivation.
JK: Natürlich sitzt man in einem Hamsterrad. Dann hat man aber einen Termin an einem frühlingshaften Tag, läuft über die Museumsinsel und führt sich vor Augen, woran man eigentlich arbeitet. Das ist eine enorme Aufgabe und natürlich auch eine große Verantwortung. Ich glaube, dass wir der gerecht werden. Besser und moderner könnten die jetzt schon eröffneten Räume gar nicht sein – auch wenn sie im Wesentlichen die alten geblieben sind.
Wie sind die Beziehungen innerhalb der Werkgemeinschaft und der Bauherrschaft?
JL: Die große Qualität, die die Säle bekommen werden und auch alle weiteren Räume, ist der Tatsache zu verdanken, dass wir ein sehr gutes Team haben und dass das Büro Kleihues und BAL gut zusammenarbeiten. Ich denke besonders an Ulrich Lausen, der seit letztem Oktober auch Projektleiter für den Bauabschnitt B ist, und an Andreas Haase, Simone Berger, Katharina Maske, Volker Israel, Manfred Kruschwitz, Christian Müller, Peter Fuss, Jenny Pochert und viele mehr, die schon seit 15 Jahren übermenschlichen Einsatz zeigen und dafür sorgen, dass wir eine sehr hohe Qualität bekommen werden. Ohne sie wäre das alles nicht möglich.
JK: Auf der Arbeitsebene haben wir mit dem BBR eine sehr gute Beziehung. Da haben wir wirklich Glück, das ist nicht immer so. Da ist auf der Projektleiterebene ein Verständnis vorhanden – für die Architektur, für das, was wir wollen, für das, was Ungers wollte…
Mit Jan Kleihues und Jörg Lenschow sprach DBZ-Redakteurin Amina Ghisu am 28.03.2025 in Berlin.