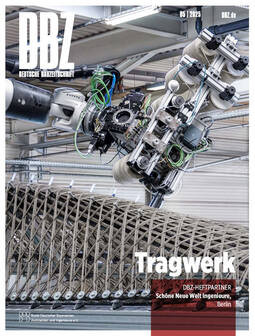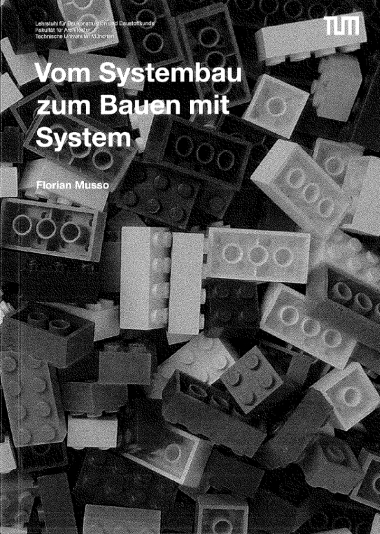Abrissdebatte(n). Ein Einwurf
So viel Abriss war nie. Stimmt? Eher nicht. Abgerissen wurde immer schon, nur gehörte das zum Alltäglichen im Baugeschäft. Wer heute ein Gebäude abreißt – eher auch: abreißen lässt – hat vielleicht ein schlechtes Gewissen oder doch zumindest ist ein Bewusstsein dafür da, dass Abriss nicht die Lösung ist. Nicht die schnelle Lösung oder wie Lucius Burckhardt es nennt, „die saubere Lösung“ (Saubere Lösungen – schmutzige Umwelt. – In: Werk und Zeit Nr. 3, 1980).
Das Burckhardt-Zitat klingt ein wenig wie aus einem Killer-Thriller, in dem ein Auftraggeber vom Auftragnehmer eine „saubere Lösung“ einkauft. Was immer meint: Es muss bald passieren und: Keine Spuren hinterlassen! Tatsächlich gibt es neben Abrissen, die aus Gier oder Dummheit, dem scheinbaren Mangel von Alternativen oder schierer Verzweiflung beauftragt werden, auch die ideologisch begründeten. Wenn Architektur für eine nicht passende politische oder gesellschaftsformative Sache steht, dann wird sie gerne auch einmal gelöscht und auf ihren Grundmauern das errichtet, was der Abreißerideologie eher entspricht. Und damit wären wir bei der These einer Publikation, die eigentlich auf eine klassische Rezension wartete, dann aber derart viele Perspektiven auf die Abrissdebatte öffnete, dass sie für diesen Text hier herhalten muss: „Die Abrissfrage“. Eine Herausgeberarbeit von Luise Rellensmann und Alexander Stumm, gerade erschienen im Berliner Jovis Verlag in dessen offenbar neuer Reihe: „Fundamente. Ökologisches Bauen.“ Die Publikation macht gleich mit der Feststellung auf, dass Abriss politisch sei, was nicht überrascht, denn alles Handeln, insbesondere auch das Nichthandeln, ist politisch. Was der Herausgeber mit der Einleitung und „Zur Kritik einer Baupraxis“ als politisch ausmacht, ist der offensichtliche Widerspruch in der Selbstverpflichtung der Bundesregierung zur CO2-Neutralität bis 2045 über alle Bereiche einerseits, wie andererseits die die CO2-Freisetzung in Kauf nehmende Politik einer Wirtschaftsförderung durch Laissez-fair-Haltung beim Verkehr und kontraproduktiver Förderung des Neubauens.
Wir sind alle verantwortlich
12 572 Gebäudeabrisse, so ist in der Publikation zu lesen (7), wurden 2022 in Deutschland statis-tisch erfasst. Man kann von einer wesentlich höheren Zahl ausgehen. 230 Mio. t Bau- und Abbruchabfälle müssen jedes Jahr entsorgt werden, davon werden nur 7 % rezykliert und kommen zurück in den Hochbau. Das meiste wird downgecycelt, im Straßenunterbau verwendet, thermisch verwertet oder auf Deponien gelagert. Das kennen wir alle, die Zahlen wiegen weniger schwer in ihrer ständigen Wiederholung: Gewöhnungseffekt. Woran sich der Autor aber nicht gewöhnen möchte, ist der Hinweis des Herausgebers, dass Architektinnen nicht in der Lage sein sollen, „die derzeitige Abrisspraxis hin zu einer ökologisch und sozial gerechten Umbaupraxis umzuschwenken“ (12); es sei denn, man begreife sich als politischer Akteur. Aber der sind wir definitiv, folgen wir dem Eingangszitat und seiner Auslegung, dass nämlich Abriss politisch sei und also wir aktiv oder passiv mittendrin in der Verantwortung stehen.
Die Abrissdebatte ist allgegenwärtig. Dass sich dennoch so wenig bewegt, hängt an vielen Dingen, von denen einige hier im Buch zusammengetragen wurden, beispielsweise die lange Abrisstradition in Europa. So geht der Rückblick in die Geschichte der Zerstörungspraxis zu den spektakulären Stadtsäuberungen à la Georges-Eugène Haussmann, der Paris nahe am Herzen nach den damals für modern gehaltenen Mitteln als mittelalterlich gewachsene Stadt auslöschte und in das Coronargewebe des Stadtkerns Stents setzte, allerdings martialische Schneisen, in denen vor Frau Hidalgo Autos dichtgepackt stehend Abgase absonderten und das Reden im Straßencafé zum Schreigespräch mutieren ließen.
Neubau ist lange schon eine Geldanlage
Der neue Stadtgrundriss der Seine-Metropole verlängerte sich in die Peripherie, auch hier wurde abgerissen und entsorgt, darunter mehr als 300 000 Menschen, die schlicht keine Wohnungen mehr hatten. War die Abrissorgie unter Haussmann noch mit einem Fit for Future zu erklären, eine Perspektive, die die Stadt in Richtung Objekt und Ökonomisierung bringen sollte, kristallisiert sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Prozess der Wandlung von Ort in Objekt heraus, von Heimat in Wertanlage. Beschrieben wird das anschaulich in der hier (17) genannten, 1911 erschienen Publikation „Building for Profit – Principles Governing the Economic of Real Estate“ von Reginald Pelham Bolton. Die hier aufgestellten Berechnungen zeigen ein Wohnhaus als ein Anlageschäft, das die höchste Rendite dann abwirft, wenn Volumen, Flächen und Kosten in einem richtigen Verhältnis stehen und es jünger ist.
Auch das ist alles bekannt, die Herleitung des Abrissmechanismus aus der Geschichte – Pelham Bolton nimmt recht kurze Lebenszyklen für ein einträgliches Gebäudebewirtschaften an – erklärt jedoch nicht die unwidersprochene Hinnahme des vielfachen Abreißens heute landauf und landab. Die „Hand Gottes“, nämlich die von Le Corbusier, die auf einer berühmten Fotografie über einem gänzlich neuen Paris in der Luft hängt, über seinem Modell des „Plan Voisin“, hat den radikalen Abriss für viele Stadtplaner der Moderne als legitimes Mittel etabliert. Zugleich ist diese Haltung, die – und das werden wir später lesen – auch einer männlichen Allmachtsphantasie entspringt, der Grund für die Moderne-Kritik, die zurecht darauf hinweist, dass es nach der ersten Zerstörung deutscher Städte im Krieg 1939–45 eine zweite gegeben habe: die ambitionierte Neuplanung von für untauglich klassifizierten Stadtgrundrissen über ihre gewachsene, historische Grundfigur hinweg. Dass mit dieser Moderne-Kritik aber weniger eine verfehlte Zukunftsplanung adressiert wird, dass es sich vielmehr auch um die Artikulation von Phantomschmerzen ob des Verlusts von Heimat und Tümelei handelte, das ist ein anderes Thema.
Überraschend kommt die „Penetration“
Doch bevor in dem Buch die Ableitung einer nicht mehr hinterfragten Abrisskultur aus der Historie endet, kommt man noch zu Rem Koolhaas, dem hier mit Recht unterstellt wird, dass trotz aller Geschichtsbewahrung und -reflexion des Geschichtlichen an Umbau niemals gedacht wird. Hier deutet sich ein wesentlicher Aspekt an: Abriss steht vielleicht vs. Neubau, doch es geht um den Umbau (auch den der Gewissheiten).
Man könnte nun die vorliegende Arbeit dahingehend durchforsten, welche Stichworte in der Abrissdebatte die zielführenden sind. Ökonomisierung von Boden und Bauten ist zentral – Stichwort Konsumismus –, doch neben der Gentrifizierung kommt sehr überraschend auch die „Penetration“: das Kapitel „Von penetrierenden Werkzeugen und phallischen Baggern. Ein Recherchebericht“ von Martha Seeger und Lukas Strasser geht der höchst wirksamen – auch aus Sicht des Autoren dieses Beitrags – Penetrationskraft der Sprache nach. Die beiden Autorinnen nehmen hier die Wortwahl und den Sprachduktus der Abrissindustrie unters Seziermesser und finden – vielleicht auch nicht überraschend – unendliche Analogien in der Abreißersprache zum Sprachgebrauch in der männlich hegemonialen Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Dass auch Abrissunternehmen heute dabei sind – meist von Agenturen beraten –, Geschlechterrollen aufzubrechen, führt dann dazu, dass das Festgefügte nur bestätigt wird. Jetzt schwingt die starke Frau den Hammer und bringt das andere Festgefügte zum Einsturz.
Überraschend in der Kombination der Einträge ist das an diesen erhellenden Beitrag anschließende Glossar „Abrisswerkzeuge und Genderkompetenz“ (108 ff.), in dem durchaus exotisch anmutende Werkzeuge für den Abbruch – Flachmeißel (mechanisch) oder Kreuzhacke (manuell geführt) – zwischen Genderthemen, hier „Genderkompetenz“, eingefügt werden. „Neoliberaler Feminismus“ steht dann ein paar Einträge vor der „Planierraupe“ (Baumaschine) oder dem „Pulverisierer“ (Baggeranbaugerät), von welchem letzterer der Autor noch nie zuvor hörte.
Im besten Sinne ideologisch
Es gibt den Hinweis auf das „Abbruchmoratorium“, einem offenem Brief vom September 2022 an die damalige Bundesministerin Klara Geywitz. Es gibt einen Beitrag, der sich sehr tröstlich der Frage zuwendet, was denn die Architekten und Ingenieurinnen in Zukunft machen sollen, wenn sie nicht mehr neubauen dürfen? Dürfen sie nicht mehr? Doch, sie dürfen, so die kollaborative Praxis ANA in ihrem Beitrag, aber vielleicht in einem anhaltenden Transformationsprozess, in dem zwar das Ziel notiert ist, wenig zu bauen, dafür „noch mehr zu gestalten – nämlich Räume, Prozesse und Strukturen gleichermaßen“ (145). Was dazu führen könnte, das „Produkt Gebäude“ ein stückweit dem Markt und seinen Gesetzen zu entziehen und es wieder zum Ort zu machen.
Wir finden weiteres, Stichworte, Empfehlungen und die Andeutung einer Strategie, die sich aber wohl jede Leserin selbst erarbeiten muss.
Damit komme ich zum letzten Aspekt, der dieses Buch für die Debatte wirksam macht. So haben Studentinnen der Hochschulen TU Berlin, BTU Cottbus, Uni Kassel und Hochschule München 64 Abrissprojekte in Deutschland recherchiert (vollzogen oder darauf wartend) und je einen kurzen Steckbrief erstellt. Dazu kommt je eine isometrische Darstellung des Volumens, die eingängig Größe und Gestalt vermittelt und damit das Abrissvolumen verdeutlicht wie zugleich den Wertverlust durch die Ausradierung eines einmal gestalteten Bauwerks deutlich werden lässt. Dass einige der Projekte bereits wackeln, könnte Anlass sein, sie ein letztes (?) Mal zu besuchen!
Die Abrissdebatte wird schnell ideologisch geführt, die Fronten sind fest. Das Ideologische kann aber, wenn es als offener Ideenaustausch begriffen wird, hilfreich sein, die Debatte zu erneuern. Die vorliegende Publikation macht dazu viele neue Türen auf, ideologisch motiviert sind sie alle – im besten Sinne verstanden!
Benedikt Kraft/DBZ