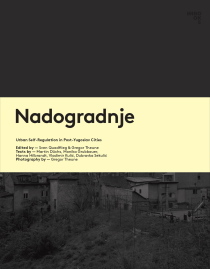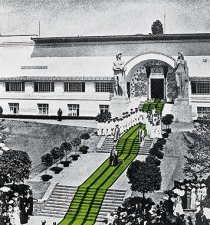Aufforderung, zu schauen
Geschichte als ein erklärbares Zeitkontinuum zu begreifen, steht längst in Frage. Der Epochenbegriff verliert in der zunehmenden Alltags- und Regionalgeschichte seine Bedeutung. Kulturelle Partikularität in einst als homogen definierten Kulturlanden stört zunehmend den Wohlklang eines wirkmächtigen Basso continuo der Welterklärer, die sich von jeher schon in klerikalen, neokonservativliberalen Wissenschaftseliten vereint haben. Diese Eliten wehren sich, greifen ihrerseits kritische Begriffe und die von ihr getragene Begriffswelt an, beispielsweise die der Utopie. Die ist – per se – nicht ideologiefrei, und gerade in der Literatur, der bildenden Kunst, aber auch und besonders in der Architektur hat sie in der Moderne – direkt aus ihrer literarischen Überlieferung heraus – erkenntnisfördernde Effekte.
Doch wie der Epochenbegriff auch, ist die Utopie an ein Ende gekommen. Ihre Manifestation als gebauter (weißer, noch unbeschriebener) Raum oder als Lehrmeinungen negierende Struktur geriet, weil in der gebauten Welt zu schlecht gemacht oder zu teuer und schlecht gemacht oder schlicht zu neu, zunehmend in die Kritik. Utopie als gebautes Lebens-, als Gemeinschaftsmodell, das war zu sehr partizipativ, zu sehr Gruppe und zu wenig auf das Subjekt zielend. Spätestens in der Postmoderne war die Utopie (im Diskurs) aufgelöst, erlebte ihre letzten Höhepunkte dort, wo sie herkam: in der Literatur (und im Film).
Aber ist das wirklich so? Sind die Moderne und die ihr impliziten, gesellschaftspolitisch Avantgarde sein wollenden Modelle vom Tisch? Sandra Meireis glaubt (hofft?), dass das nicht so sei und macht sich in ihrer Dissertation auf die Suche nach den Resten der großen Utopien, die sich seit der Begriffseinführung durch Thomas Morus 1516 entwickelten und die von allen Wissenschaften und Künsten (so auch der Architektur) ausgiebig rezipiert und in die unterschiedlichsten Bilder übersetzt wurden. Und sie hat – nach längerer, sehr systematischer, semantischer, etymologischer und wissenschaftskritischer Aufbereitung der Motivik – Reste gefunden. „Mikro-Utopien“ nennt sie diese, eine Wort-, eine Begriffsneuschöpfung, die die Autorin hier wieder neu lanciert, auch, um in einem möglichen Diskurs über das Rest-Utopische den eigenen Namen platziert zu haben.
Aber, ist eine Rettung der Utopie in praxisnahen Alltagsgeschichten schlüssig? Oder einfach nur banal? Denn mit dem Erscheinen des Menschen im Holozän kamen, wie so viele andere bereits wahrgenommene und immer noch missachtete Möglichkeiten auch die Utopie in die Welt. Immer als der Mechanismus, eine kritische Reflexion zu unternehmen und meist mit dem Anspruch, die Gesellschaft fortzuentwickeln. Dass diese ganz Große und von allen Kulturen und Unkulturen beanspruchte Idee sozialen Zusammenseins in dieser konzentrierenden Arbeit eher nicht vorkommt, sondern vor allem die Aufforderung mitschwingt, die niemals vollendete Utopiegeschichte in kleinsten, plural verfassten, auf Toleranz zielenden und das Politische reanimierenden Raumgeschichten weiterzuschreiben, das ist möglicherweise der Gewinn einer Lesereise, die nicht nur den Historiker fasziniert, den aber auch. Be. K.