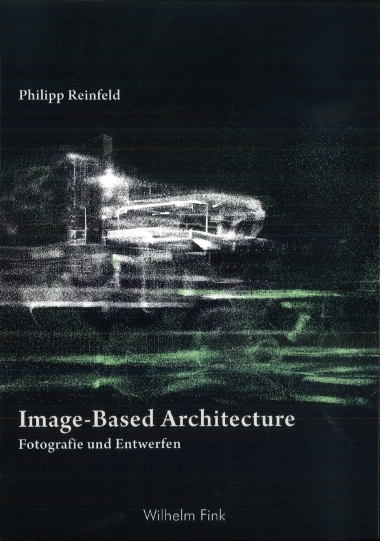Liebe Leserinnen, liebe Leser,
beim Wort Umbauen klingt immer eine gewisse Unzufriedenheit mit: Etwas passt, gefällt, funktioniert nicht mehr und wird deshalb auf links gedreht. In der Vergangenheit standen dabei zumeist die veränderten Ansprüche der Eigentümerinnen und Eigentümer im Fokus und auch sie mäkelten vor allem am Bestand herum: Er genügt nicht mehr dem gewachsenen Platzbedürfnis. Das Raumprogramm wird als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Die Ansprüche an den Komfort sind heute andere – oder die Architektur gilt einfach als modisch nicht mehr up-to-date.
In diesem Geist war der Umbau immer nur ein Kompromiss, der dann geschlossen wurde, wenn der Abriss aus politischen, gesellschaftlichen oder denkmalpflegerischen Gründen nicht opportun war – oder schlicht die Mittel für einen Ersatzneubau nicht ausreichten. Denn auch aus ökonomischer Sicht waren Neubauten nie günstiger als die Weiterverwendung des Vorhandenen. Diese, insbesondere von Investoren immer wieder vorgetragene Milchmännchen-Rechnung geht nur dann auf, wenn man vom Bestand verlangt, was er aus sich selbst heraus nicht leisten kann. Nach dem Motto: Diese Hütte zum Schloss umzubauen, wäre viel zu teuer, also machen wir sie platt. Die Zeiten sind – und man möchte, trotz der vielen endzeitlichen Szenarien, die uns zum Umdenken zwingen, fast sagen: zum Glück! – inzwischen andere. Denn, wer es mit dem Thema „Bauen gegen den Klimawandel“ ernst meint und nicht nur produkttechnische „Innovationen“ unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit vermarktet, der hat verstanden, dass wir den Blick auf das Vorhandene richten müssen. Und wie gute Partner und Partnerinnen müssen wir dabei nicht in erster Linie auf das schielen, was uns das Gegenüber bieten kann – sondern auf das schauen, was wir ihm zu bieten haben: an Kreativität, Gestaltungswillen und den Mut, neue Wege zu gehen.
Unsere Heftpartner in dieser Ausgabe, weberbrunner architekten aus Zürich und Berlin, haben sich dieser Aufgabe längst angenommen. Gemeinsam mit ihnen haben wir vier Projekte ausgesucht, die das Thema Umbau exemplarisch an unterschiedlichen Typologien und baulichen Aufgabenstellungen durchexerzieren. Dabei hat uns überrascht, wie tragfähig das Prinzip „Stärken nutzen, statt Schwächen überbauen“ ist. So gelingt ein großmaßstäblicher Umbau wie der des Felix Platter Spitals in Basel (S. 40), das in sperriger Schottenbauweise erstellt wurde, ebenso, wie der minimalinvasive Eingriff, der in Berlin ein Fastfood-Restaurant in eine Kunstgalerie verwandelt hat (S. 48). Ja, oftmals zeigt sich sogar, wie der schlecht gedachte Umbaubegriff von damals, ähnlich wie in einer toxischen Partnerschaft, zu einer Verschlechterung des Status Quo geführt hat, die heute einer erneuten Überarbeitung bedarf (S. 58). Ist der Begriff „Umbau“ nun ein Begriff der Unzufriedenheit? Vielleicht. Wir können ihn aber gemeinsam umdeuten, wenn wir ihn nicht mehr als Begriff des Immer-Mehr, sondern des Mehr-aus-Weniger verstehen. Entdecken Sie in dieser Ausgabe, welche Ansätze es dazu heute bereits gibt.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Jan Ahrenberg